.gif)
das literarische nachrichtenmagazin
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Entdecker entdecken!
National History Museum (Hrsg.): „Naturerkundungen mit Skizzenheft und Staffelei. 23 Forschungsreisende aus vier Jahrhunderten"
Von Anne Spitzner
 Es
gab einmal eine Zeit, in der die Weltkarte noch große weiße Flecken
aufwies. Eine Zeit, in der man über das Innere des Urwalds oder die
Schwärze der Tiefsee noch weniger wusste als heute. Und eigentlich ist
diese Zeit noch gar nicht so lange her…
Es
gab einmal eine Zeit, in der die Weltkarte noch große weiße Flecken
aufwies. Eine Zeit, in der man über das Innere des Urwalds oder die
Schwärze der Tiefsee noch weniger wusste als heute. Und eigentlich ist
diese Zeit noch gar nicht so lange her…
Im vom National History Museum herausgegebenen Band „Naturerkundungen mit Skizzenheft und Staffelei“ folgt der Leser 23 Forschungsreisenden, welche es sich zum Ziel gemacht hatten, mehr über die weißen Flecken auf der Landkarte herauszufinden und ihre Entdeckungen mit dem Rest der Welt zu teilen. Dafür fertigten sie Zeichnungen an – einerseits, um die interessierte Öffentlichkeit an ihren Funden teilhaben zu lassen, aber auch, um sie wissenschaftlich korrekt sowohl für die Nachwelt als auch für ihre Forscherkollegen aufzubereiten. Im Rahmen dieser Forschungsvorhaben entstanden Zeichnungen, die wunderschön anzusehen und gleichzeitig hochgradig informativ sind.
Viele dieser Zeichnungen sind im Buch abgedruckt, und in den dazugehörigen Kapiteln wird ihre Entstehungsgeschichte bzw. die Geschichte des Forschers oder der Forscherin erzählt, der oder die sie gezeichnet hat. Da fallen natürlich klangvolle Namen wie Charles Darwin, Alexander Humboldt oder Maria Sibylla Merian, aber auch weniger berühmte, wenngleich nicht weniger bedeutende Naturforscher und -zeichner werden gewürdigt.
Die Essays über die einzelnen Naturforscher*innen sind jeweils von unterschiedlichen Autor*innen verfasst worden und bieten so auch unterschiedliche Lese-Erlebnisse (wobei an einzelnen Stellen auch die Übersetzung noch eine Rolle spielen mag). Jedoch ist ihnen allen gemein, dass sie den Leser eintauchen lassen in die Welt vor 150 oder 250 Jahren. An vielen Stellen sind sie für meine Begriffe beinahe ein wenig zu knapp ausgefallen, aber man kann dieses Buch ja auch als Appetithappen auffassen, sozusagen als Anlass, sich mit den beschriebenen Personen in weiterer Literatur noch etwas näher zu befassen.
Einige der Kapitel folgen recht genau den Biographien der beschriebenen Personen, andere steigen mittendrin ein und kommen dann später wieder auf frühe Erlebnisse zurück. Schön ist, dass nicht allzu viel mit Jahreszahlen jongliert wird – dass nicht allzu viele Nebenschauplätze aufgemacht werden, was z.B. zeitgenössische Entwicklungen angeht, mag jeder finden, wie er will. Einerseits fehlt so einem Leser, dem dieses Wissen nicht abrufbereit im eigenen Gehirn zur Verfügung steht, so manches Mal die Möglichkeit zu Einordnung, andererseits täten natürlich zu viele Erläuterungen auch der Lesbarkeit Abbruch.
Schade ist eigentlich nur, dass an zahlreichen Stellen ausführlich von Bildern die Rede ist, die dann gar nicht in dem entsprechenden Kapitel auftauchen, in dem stattdessen dann andere Bilder abgebildet sind. Natürlich muss auch das National History Museum mit dem Material arbeiten, das es hat, aber dann hätte man beim Schreiben der Texte doch auch auf die vorhandenen Bilder abzielen können.
Doch insgesamt ist „Naturerkundungen mit Skizzenheft und Staffelei“ ein spannendes, informatives und vergnügliches Buch, bei dem man bewundernd und/oder träumend von den Abenteuern vergangener Forscher- und Entdeckergenerationen lesen kann (während man sich derzeit und heutzutage gemütlich auf dem Sofa einkuscheln kann und weder Mückenschwärme und Tropenhitze noch Antarktiskälte oder raue See am eigenen Leib erleiden muss).
Die Rezensentin ist promovierte Biologin. Von ihr ist zuletzt erschienen: "Watt fürs Leben. Zivil- und Freiwilligendienst bei der Naturschutzgesellschaft Schutzstation Wattenmeer e.V. von 1971 bis 2011"
![]()
Menschen in China, die sich im Existenzkampf behaupten
Michael Gleich: Drache auf tönernen Füßen
Von Anne Spitzner
„Drache auf tönernen Füßen“ ist ein literarischer Reisebericht durch ein China nach Mao. Ein China, in dessen Köpfen der Große Vorsitzende dreißig Jahre nach seinem Tod immer noch präsent ist, das gerade versucht, auf dem einen oder anderen Weg mit der Herrschaft, den Hinterlassenschaften, dem Traum(a) Mao fertig zu werden.
Genauer gesagt führt Michael Gleich uns in „Drache auf tönernen Füßen“ in die chinesische Provinz Zhejiang, die von Mao lange Zeit vernachlässigt, regelrecht benachteiligt wurde; sie liegt an der chinesischen Grenze und wurde von Mao als potenzielle Überläuferregion betrachtet. Hier waren die Menschen zu Maos Zeiten ärmer als arm, außer auf dem Land gab es keine Arbeit, die Strukturen waren starr und ineffizient – nur, wer die Parteifunktionäre bestach, kam weiter. Doch die Menschen von Zhejiang haben es geschafft, das zu ihrem Vorteil zu drehen. Diffuse, wirre Geldverleihsysteme, bedingungslose Zusammenarbeit, Risikobereitschaft und eisernes Durchhaltevermögen haben dafür gesorgt, dass hier ein boomender Markt entstanden ist, ob dort nun Feuerzeuge gehandelt werden oder Schmuckkästchen.
 Inmitten
all dieses Gewirrs bewegt man sich zusammen mit dem Autor und seinen
verschiedenen Begleitern, die er auf mehreren China- Reisen
kennengelernt hat – Übersetzer, Auswanderer, Einheimische, Fremdenführer
und Mitreisende. Zu Beginn ist es ein wenig verwirrend, dass Gleich
zwischen seinen verschiedenen China- Reisen hin und her springt, aber
wenn man sich einmal davon verabschiedet hat, einen zeitlichen
Erzählstrang verfolgen zu wollen und stattdessen den inhaltlichen
weiterverfolgt, macht das weiter nichts aus. So erfährt man
beispielsweise die Erfolgsgeschichten einiger ehemaliger Bauern aus
Zhejiang, die jetzt Großindustrielle sind. Mit Feingefühl und viel
Vorbereitung kitzelt Gleich auch Bestandteile ihrer Geschichten aus
ihnen heraus, die sie vielleicht gar nicht erzählen wollten. Vielleicht
aber auch doch – auch die Verständigungsschwierigkeiten zwischen ihm,
den Dolmetschern und den Zeitzeugen schildert Gleich, beschreibt
anschaulich die Spuren, die die Zeit und der harte Weg nach oben an den
Männern hinterlassen haben, die oft vor ihrer Zeit gealtert sind. Auch
ihr Unbehagen beim Gespräch über die Ursprünge ihrer Betriebe spürt man
zwischen und in den Zeilen deutlich – teilweise war nicht alles ganz
legal, bewegte sich zumindest im Grenzbereich, und auf jeden Fall war es
alles gegen Maos Überzeugungen und Direktiven.
Inmitten
all dieses Gewirrs bewegt man sich zusammen mit dem Autor und seinen
verschiedenen Begleitern, die er auf mehreren China- Reisen
kennengelernt hat – Übersetzer, Auswanderer, Einheimische, Fremdenführer
und Mitreisende. Zu Beginn ist es ein wenig verwirrend, dass Gleich
zwischen seinen verschiedenen China- Reisen hin und her springt, aber
wenn man sich einmal davon verabschiedet hat, einen zeitlichen
Erzählstrang verfolgen zu wollen und stattdessen den inhaltlichen
weiterverfolgt, macht das weiter nichts aus. So erfährt man
beispielsweise die Erfolgsgeschichten einiger ehemaliger Bauern aus
Zhejiang, die jetzt Großindustrielle sind. Mit Feingefühl und viel
Vorbereitung kitzelt Gleich auch Bestandteile ihrer Geschichten aus
ihnen heraus, die sie vielleicht gar nicht erzählen wollten. Vielleicht
aber auch doch – auch die Verständigungsschwierigkeiten zwischen ihm,
den Dolmetschern und den Zeitzeugen schildert Gleich, beschreibt
anschaulich die Spuren, die die Zeit und der harte Weg nach oben an den
Männern hinterlassen haben, die oft vor ihrer Zeit gealtert sind. Auch
ihr Unbehagen beim Gespräch über die Ursprünge ihrer Betriebe spürt man
zwischen und in den Zeilen deutlich – teilweise war nicht alles ganz
legal, bewegte sich zumindest im Grenzbereich, und auf jeden Fall war es
alles gegen Maos Überzeugungen und Direktiven.
Insgesamt ist „Drache auf tönernen Füßen“ ein Essay über den Willen der Menschen, ein besseres Leben zu führen, eine Reportage über Menschen in China, die sich im Existenzkampf behaupten, und ein Lagebericht aus einer Provinz, die sich vom „Bauernstaat“ zum „Industriestaat“ wandelt. Man kann viel über die chinesische Sozialstruktur und Denkweise erfahren. Lesenswert ist „Drache auf tönernen Füßen“ also auf jeden Fall – aber als an China interessierter Leser hat man es logischerweise ein wenig leichter.
Michael Gleich:
"Drache auf tönernen Füßen. Die Entdeckung der Individuen in China"
Picus 2011
334 Seiten, Euro 23,90
ISBN 978-3854526735
![]()
Nachruf auf Schauspieler und Schulpflicht-Gegner Heinz Bennent
Von Thomas Werk
Der Schauspieler Heinz Bennent ist am 12.10.2011 in Lausanne im Alter von 90 Jahren verstorben. Er wurde am 18. Juli 1921 in Atsch geboren und debütierte 1974 mit dem umjubelten Stück „Don Carlos“ am Staatstheater in Karlsruhe. Der eigenwillige Freigeist Bennent war ein bekennender Schulpflicht-Gegner. Das ergab sich logisch aus seiner Biographie; er wurde aus der Hitler-Jugend wegen "mangelnden Gehorsams" ausgeschlossen. In den siebziger Jahren lebte die Familie in Berlin-Kreuzberg. Die beiden Kinder wurden zuhause unterrichtet - bis Nachbarn sie denunzierten. Bennent, der von sich sagte, er sei "äußerst allergisch gegen Autorität", ging keine Kompromisse ein. Er zog mit Frau und Kindern nach Griechenland, die Kinder Anne und David wuchsen weiter unbeschult auf. Sie sind heute beide bekannte Schauspieler. Mit seinem Sohn spielte er 1995 in Lausanne in der Inszenierung von Becketts „Endspiel“ - sein größter Theatererfolg. Aber auch als Filmschauspieler machte sich Bennent einen Namen. Sein größter Erfolg war „Die letzte Metro“ mit Catherine Deneuve unter der Regie von Francois Truffaut, in dem er einen jüdischen Theaterdirektor in der Nazizeit spielte.
Unter anderem spielte er auch unter der Regie von Ingmar Bergman („Das Schlangenei“) und Volker Schlöndorff („Die Blechtrommel“, gemeinsam mit Sohn David). Bennent spielte in mehr als 150 Rollen mit. Mit ihm verliert Deutschland einen bedeutenden Schauspieler, als Vorbild für den Kampf gegen die Schulpflicht bleibt er lebendig.
![]()
Mitten hinein in das Teheraner Leben
Parsua Bashi: Briefe aus Teheran
Von Carolin Kotsch
Es bestehen deutliche Unterschiede zwischen der iranischen Hauptstadt Teheran und einer westlichen Stadt. Das ist dem Leser von vornherein klar. Aber worin bestehen die Unterschiede im Einzelnen, was sind die Besonderheiten Teherans, welche Vor- und Nachteile hat das Leben dort, welche Vorurteile sind begründet, welche völlig haltlos? Das sind die Fragen, denen sich die gebürtige Teheranerin Parsua Bashi widmet. Dabei wirft sie den Leser mit dem 2010 bei Kein & Aber erschienen autobiographischen Roman mitten hinein in das Teheraner Leben. Sie erzählt von ihren Erfahrungen und macht dabei Angaben über Politik und Kultur, die Beziehung zwischen Mann und Frau, Essgewohnheiten, den Umgang mit Alkohol und die überall vorherrschende Korruption und verpackt sie geschickt in kleine Geschichten und Anekdoten, sodass es dem Leser leicht fällt, diese vielfältigen Informationen aufzunehmen.
 Dabei erhält man den Eindruck, dass das Teheraner Leben ungeordneter
ist als das einer westlichen Stadt, dass es große Spannungen im
öffentlichen Leben und nervenzerreißende Probleme und Einschränkungen im
Alltag gibt. Aber der Leser erfährt auch von einem starken Zusammenhalt
des Volkes in der Auflehnung gegen die Zensur in der Kunst und die
raffinierten Möglichkeiten diese möglichst zu umgehen.
Dabei erhält man den Eindruck, dass das Teheraner Leben ungeordneter
ist als das einer westlichen Stadt, dass es große Spannungen im
öffentlichen Leben und nervenzerreißende Probleme und Einschränkungen im
Alltag gibt. Aber der Leser erfährt auch von einem starken Zusammenhalt
des Volkes in der Auflehnung gegen die Zensur in der Kunst und die
raffinierten Möglichkeiten diese möglichst zu umgehen.
Trotz größter dargestellter Unterschiede werden auch Gemeinsamkeiten zu einer westlichen Stadt erkennbar gemacht. Diese bestehen beispielsweise im Verhalten der Jugend, was die Autorin an der Darstellung ihrer Tochter deutlich macht.
Parsua Bashi schafft es dem Leser mit Hilfe verschiedener Darstellungsweisen einen nahezu distanzlosen Einblick in den Alltag ihrer Geburtsstadt zu vermitteln, ohne dabei jedoch den roten Faden zu verlieren. Besonders lebendig gelingt es ihr dabei eine Theateraufführung zu beschreiben, der es trotz aller einschränkender Kulturpolitik, oder gerade deswegen, gelingt, die Beziehung zwischen Mann und Frau sehr erotisch darzustellen.
Ständige Rückgriffe und Wiederholungen lassen den Roman jedoch langatmig erscheinen und nehmen ihm etwas von seiner Frische.
Parsua Bashi:
"Briefe aus Teheran"
Kein und Aber 2010
192 Seiten, Euro 18,90
ISBN: 978-3036952758
![]()
Michael Stausberg: "Religion im modernen Tourismus"
Von Tobias Hofer
Tourismus und Religion? Man kennt die Bahnhofsmission vom Sehen, und im Flughafen geht man an eingebauten Kapellen vorbei. Mehr fällt einem zuerst nicht ein. Michael Stausberg, Professor für Religionswissenschaft in Bergen / Norwegen, hilft uns, die wir neben vielem Individuellen so gut wie alle auch Touristen sind, auf die Sprünge. In seinem Buch „Religion im modernen Tourismus“ fasst er das Phänomen „Religion im modernen Tourismus“ (so der Titel) zusammen, und der Leser ist immer wieder überrascht. Es ist ein „Na klar!“ – Erstaunen, ein Augenöffnen inmitten des oft Gesehenen und doch nicht Verstandenen. Denn Religion und Tourismus, so startet Stausberg in seine unkompliziert formulierten Ausführungen, sind in gängiger Vorstellung Gegensätze: In vielen Belangen, unter anderem gilt das eine als oberflächlich, als Spaß, das andere als tiefgründig, als ernst.
 Wer
dann losfährt, will Kirchenbesuche als Touriprogramm konsumieren, eine
Abwechslung. Da nimmt man gern religiöse Feiern anderer
Glaubensrichtungen mit. Buddhismus ist besonders beliebt neben
Christentum – Touristen aus anderen Religionen muss man oft sagen, dass
sie im Petersdom nicht essen und Krach machen sollen. Der Kirchbesuch
sinkt zu dem herab, was Tourismus soll; die leichte Kost.
Wer
dann losfährt, will Kirchenbesuche als Touriprogramm konsumieren, eine
Abwechslung. Da nimmt man gern religiöse Feiern anderer
Glaubensrichtungen mit. Buddhismus ist besonders beliebt neben
Christentum – Touristen aus anderen Religionen muss man oft sagen, dass
sie im Petersdom nicht essen und Krach machen sollen. Der Kirchbesuch
sinkt zu dem herab, was Tourismus soll; die leichte Kost.
Parallel dazu machen sich mehr und mehr Leute auf die Socken, um zu pilgern (Stausberg erläutert die publizistische und touristische Vorgeschichte von Kerkelings Jakobsweg-Bestsellers). Sie machen sich zu Touristen, um zum Glauben zu finden. Nur ein kleiner Schritt, und man weiß, dafür braucht es gar nicht alte Glaubensdenkmäler. Disney genügt, und so hat sich im Schwarzwald der größte religiöse Freizeitpark Europas etabliert.
Alles wird verständlicher durch Stausbergs Buch, sympathischer wird es nicht. Zumal man die Geschichtchen der Leute über ihre Reisen nun noch kritischer vernimmt. Das tollste ist es seit ein paar Jahren, bei Feuerbestattungen in Indonesien zuzuschauen. Vorne die trauernden Buddhisten, hinten eine Busladung alternder deutscher Christen. Das steht bei Stausberg nicht, er könnte noch mehr dem Touristenvolk aufs Maul schauen. Aber wie es zu den Auswüchsen kommt, das versteht man durch das gut strukturierte und mit Details hübsch garnierte Buch.
Michael Stausberg:
"Religion im modernen Tourismus"
231 Seiten, Euro 24,90
Insel 2010
ISBN: 978-3458710271
![]()
Tomi Ungerer: "Achtung Weihnachten"
Von Cay Meyer
Wenn man das Buch in der Hand hält, großformatig, schön gedruckt, wunderbares Papier, dann fühlt man sich an gute Zeiten des Verlagswesen erinnert. Und wenn man es liest, auch: Irgendwie mag man kaum glauben, dass es aus dem Jahre 2010 ist. Man kennt es doch schon! Das lag doch vor 25 Jahren auf dem Klo in der WG, unter der Greenpeace-Magazin Ausgabe 1.
 Doch
dabei kann es nicht bleiben. Es
wäre nicht von Tomi Ungerer, wenn nicht seine Zeichnungen diese
Bissigkeit hätten. Das ist richtig gut. Und natürlich das Vorwort von
Ungerer, sowas macht er mit seiner langen Erfahrung einfach perfekt. Die
Auswahl an Erzählungen ist, nun ja, etwas für Weihnachtskritische. Da
ist es dann wieder, das Stehengebliebene – die Realität
ist so viel schlimmer mittlerweile, dass man sagen muss: Niedlich, diese Kritik!
Wäre das Buch aus der geistigen Gemengelage unserer Zeit, es hätte viel
zynischer ausfallen müssen. So hat es ja nachgerade noch etwas
Kämpferisches! Und ist so eine angenehme Lektüre.
Doch
dabei kann es nicht bleiben. Es
wäre nicht von Tomi Ungerer, wenn nicht seine Zeichnungen diese
Bissigkeit hätten. Das ist richtig gut. Und natürlich das Vorwort von
Ungerer, sowas macht er mit seiner langen Erfahrung einfach perfekt. Die
Auswahl an Erzählungen ist, nun ja, etwas für Weihnachtskritische. Da
ist es dann wieder, das Stehengebliebene – die Realität
ist so viel schlimmer mittlerweile, dass man sagen muss: Niedlich, diese Kritik!
Wäre das Buch aus der geistigen Gemengelage unserer Zeit, es hätte viel
zynischer ausfallen müssen. So hat es ja nachgerade noch etwas
Kämpferisches! Und ist so eine angenehme Lektüre.
Tomi Ungerer:
"Achtung Weihnachten"
Diogenes 2010
237 Seiten, , EUR 29,90
ISBN: 978-3257010152
![]()
Uri Gordon: Hier und jetzt!
Von Cay Meyer
Das Leben in Mitteleuropa gewinnt an Anarchie.
Seit Jahren werden die Freizeitbeschäftigungen immer anarchischer; man schläft an Stränden, man kampiert im PKW, man macht Feuer, man zeltet an Plätzen, wo man früher sofort verscheucht worden wäre. Kümmert keinen mehr.
In vielen Familien herrscht ein anarchisches Miteinander. Die wenigen Regeln stellt man mit Kindern gemeinsam auf. Es wird diskutiert und gespielt bis spät in die Nacht, auch am Dienstagabend. Anschaffungen werden nur nach Rücksprache mit Minderjährigen getroffen, und in politischen Debatten sind Meinungen Jugendlicher im privaten Rahmen gleichrangig wie nie. Kein Oben und kein Unten.
Der Staat flutet einen mit Gesetzen, aber unter dem Türschlitz lässt man nur die hindurch, bei denen man eine Strafe zahlen muss. Der Rest bleibt draußen, Einschränkungen schon mal gleich.
Das ist Anarchie in der untersten Parzelle, die nicht einfach zu erfassen ist. Auch nicht von den Strategen der anarchistischen Bewegung. Weil sie der Kleinkram nicht interessiert. Sie wollen am großen Rad drehen. Und darum zittert man vor ihnen, als Klein-Anarchist.
Uri Gordon hat in seinem Buch „Hier und Jetzt. Anarchistische Praxis und Theorie“ zusammengefasst, wie die Bewegung gegenwärtig strukturiert ist. Nicht einfach, denn Unüberschaubarkeit liegt in der Natur der Sache. Gordon stellt sich von der ersten Zeile an den Problemen – allen voran dem, dass viele Anarchisten den Begriff für sich meiden; eine Abneigung, so Gordon, die meist ihren Grund in der Ablehnung von jeglicher Etikettierung hat.
 Damit
muss man leben, als Leser und Autor. Zu klareren Erkenntnissen kommt es
dann bezüglich der „Organisationsformen“. Darüber will man etwas wissen,
wenn man ein solches Buch liest, da bringt Gordon Licht ins Dunkel. In
„Ebenen“ versucht er einzuteilen, von der Mikroebene (lokal) bis hoch
zur Makroebene (global).
Damit
muss man leben, als Leser und Autor. Zu klareren Erkenntnissen kommt es
dann bezüglich der „Organisationsformen“. Darüber will man etwas wissen,
wenn man ein solches Buch liest, da bringt Gordon Licht ins Dunkel. In
„Ebenen“ versucht er einzuteilen, von der Mikroebene (lokal) bis hoch
zur Makroebene (global).
Die Ziele der Anarchisten erzählen von geradezu traditionellen Werten, seit es Staaten und den Widerstand gegen sie gibt. Die Überwindung von Herrschaft, keine Hierarchien, Buntheit und Ergebnisoffenheit.
Schwer trägt Gordon an dem, was an Zwang, an Gewalt, an Führung doch in die anarchistischen Bewegungen fließt. Er resümiert, dass all das Friedliche, Konstruktive sich eben doch in Gewalt wandeln könnte.
Die letzten Kapitel sind dem gewidmet, was der Anarchie die neuen Impulse gegeben hat, die neuen technologischen Möglichkeiten. Im Netz sind sie alle mehr oder weniger fit unterwegs: „Maschinenstürmer, Hacker und Gärtner“ fasst Uri Gordon sie in Gruppen zusammen, und die Gärtner stehen für die Technologiekritiker.
Der Autor, Jahrgang 1976, ist selber dabei, wenn es darum geht, der Anarchie ein Gesicht zu geben. Dafür, dass er mittendrin ist, hätte man sich weniger sperrige Informationen gewünscht. Man merkt schon, dass er mit angezogener Handbremse schreibt – Feind liest mit. Darum wäre es gut gewesen, wenn das Buch zunächst die Bedingungen dessen, der gegen die Staatsmacht handelt, als Voraussetzungen abgehandelt hätte. Uri Gordons Ausführungen werden nicht ungelesen verstauben, allein die Polizeistrategen werden sie genau studieren. Feind liest mit – damit müsste man als Autor offener umgehen.
Und noch ein Punkt, bei dem ein neutraler Betrachter besser gewesen wäre: Die identitätsstiftenden Ereignisse der heutigen Anarchisten sind die Treffen der Staatschefs, auf den G-8-Treffen erlebt man seine Gemeinsamkeit und seine Kraft, die dann wieder im Individualschicksal versinkt, bis zum nächsten Mal. Das kann Gordon nicht klar erkennen und auch kritisieren. Damit geht ihm verloren, er kann nicht über Schwächen wie verstörende Normiertheit, vorurteilsbeladenes Betonkopfdenken, gar uniformiertes Aussehen schreiben. Der nächste Schritt wäre eine blinde Ideologisierung.
Vor der zittert der Klein-Anarchist. Der tägliche Minikampf für die anarchische Lebensführung hat eben auch ein ganz anderes Niveau als dieses Manifest von Uri Gordon. Es bietet einen Überblick über den gegenwärtigen politischen Anarchismus. Übrigens derzeit als einziges Buch.
Uri Gordon:
"Hier und jetzt! Anarchistische Theorie und Praxis"
Edition Nautilus 2010
256 Seiten, 18 Euro
ISBN: 978-3894017248
![]()
Europa verrottet von innen.
Es muss sich öffnen
Von Tobias Hofer
Man profitiert vom System, natürlich, vom ersten Atemzug an, man lebt warm, schimpft auf die Außengrenze, die sich Jahr um Jahr stärker zementiert, auch uns einzementiert – aber dazu später.
Aber vor allem fühlt man sich machtlos der menschlichen Kälte gegenüber, die politisch hoffähig ist. Allein, die Wut ist da.
„Nach Europa“ heißt das Heftlein (eine Rede) von Navid Kermani. Es formuliert, was an diffusen Gedanken zum Thema da ist: „Wer wissen will, wieviel dieses überbürokratisierte, apathische, satte, unbewegliche, entscheidungungsschwache Gebilde namens Europäische Union wert ist, muß dahin fahren, wo es aufhört.“ schreibt Kermani und nimmt den Leser, der sich schon länger unwohl fühlt, in seinen flammenden Aufruf mit.
Worum geht’s?
 Um
die täglichen Dramen, die sich an der europäischen Außengrenze im
Mittelmeer und im Atlantik abspielen, um die Bootsflüchtlinge, die
ertrinken, und das unter dem wohlwollenden Auge der europäischen
Einwanderungspolitik. Es ist so entsetzlich, was da passiert, und mit
welcher Kälte so ein Staatsverbund handelt, welchen Zynismus er sich zur
Grundlage seines Seins macht.
Um
die täglichen Dramen, die sich an der europäischen Außengrenze im
Mittelmeer und im Atlantik abspielen, um die Bootsflüchtlinge, die
ertrinken, und das unter dem wohlwollenden Auge der europäischen
Einwanderungspolitik. Es ist so entsetzlich, was da passiert, und mit
welcher Kälte so ein Staatsverbund handelt, welchen Zynismus er sich zur
Grundlage seines Seins macht.
Isaac Julien „Small Boats“ (gibt es zu sehen im Museum Brandhorst in München zu sehen) ist eine Videoinstallation, die von der Schutzlosigkeit der Flüchtlinge erzählt und ihr oft tödliches Schicksal thematisiert. Tod durch Ertrinken! Vor den Touristenstränden.
Jeden Tag müsste die christliche Kirche aufstehen. Jeden Tag. Aber auch sie ist ohne Idee von Europa, einem Europa, dem der Zusammenhalt fehlt, der ihn nur herbeiredet, wenn er sich nicht seinen moralischen Aufgaben stellt.
 Was
Europas heute noch an Hoffnungen hervorruft, ist das Korrektiv der
Gemeinschaft, der
Wunsch einzelner Unterdrückter in den Ländern, Europa möge helfen. Aus
dem heraus könnte Europa seine Kraft entwickeln - zu helfen, wo einzelne
Staaten Menschen gegen die Wand pressen. Da wäre Europa eine
starke Gemeinschaft, hätte eine Tradition, die mehr ist als eine
Ansammlung von Staaten.
Was
Europas heute noch an Hoffnungen hervorruft, ist das Korrektiv der
Gemeinschaft, der
Wunsch einzelner Unterdrückter in den Ländern, Europa möge helfen. Aus
dem heraus könnte Europa seine Kraft entwickeln - zu helfen, wo einzelne
Staaten Menschen gegen die Wand pressen. Da wäre Europa eine
starke Gemeinschaft, hätte eine Tradition, die mehr ist als eine
Ansammlung von Staaten.
Stattdessen soll die Abschottung nach außen Identität stiften. Die da draußen, wir hier drinnen Doch drinnen ist man nicht glücklich, den Jüngeren fehlt als ersten die Luft zum Atmen.
Und die Ausgesperrten hungern weiter. Kinder sterben.
Europa muss sich ändern. Es muss sich öffnen. Sonst verrottet es.
Navid Kermani: "Nach Europa"
Ammann Verlag, 48 Seiten, antiquarisch beziehbar
Isaac Julien „Small Boats“
Videoinstallation und als Buch (49 Seiten) bei Walther König Verlagsbuchhandlung.
![]()
oder: die Geschichte geht auf Facebook weiter.
Von Jan Fischer
„Das Netz ist da, und es funktioniert“
aus einem verschollenen Internetratgeber aus den frühen 90ern
„Facebook ermöglicht es dir, mit den Menschen in deinem Leben in Verbindung zu treten und Inhalte mit diesen zu teilen.“
Facebook-Startseite
 Bevor
ich die Mädchen entdeckte, sammelte ich Schrott. Wir wohnten in einem
kleinen Dorf mitten in Niedersachsen, so mitten, dass sowohl Hamburg und
Bremen als auch Hannover gleich unerreichbar waren. Unsere Straße - der
Birkenweg – begann asphaltiert, dann, als wäre jemandem das Geld oder
Lust ausgegangen, wurde der Asphalt zu Pflastersteinen, und ganz am
Ende, kurz, bevor die Felder begannen und der Weg einen Bogen ins Nichts
Richtung Birkenwäldchen machte, kam Schotter. Unser Haus war rot und
stand im Schotterteil der Straße. Parallel zum Birkenweg verlief eine
stillgelegte Eisenbahnstrecke. Wenn man aus der Haustür ging, über die
Schotterstraße, über den Bahndamm, und sich nach rechts, die Straße
hoch, wandte, kam man an den alten Bahnhof, der zu dem Zeitpunkt schon
ein Supermarkt war. Wenn man nach links ging, die Straße runter,
Richtung Felder, Richtung Birkenwäldchen, kam man an eine stillgelegte,
nur provisorisch eingezäunte Fabrik. Das war mein Schrottsammelrevier.
Ich weiß nicht, wie viel Schrott am Ende in dem Versteck im Wäldchen
lag, heute habe ich den Eindruck, es muss mindestens eine Tonne gewesen
sein. Ich wollte mit all dem Schrott nichts, ich schleppte ihn
kilometerweit, nicht, weil ich damit etwas bauen wollte, nicht, weil ich
irgendwas damit plante. An diese Geschichte musste ich denken, als ich –
über Facebook, natürlich – die Nachricht bekam, ich solle doch einen
Essay über Facebook schreiben.
Bevor
ich die Mädchen entdeckte, sammelte ich Schrott. Wir wohnten in einem
kleinen Dorf mitten in Niedersachsen, so mitten, dass sowohl Hamburg und
Bremen als auch Hannover gleich unerreichbar waren. Unsere Straße - der
Birkenweg – begann asphaltiert, dann, als wäre jemandem das Geld oder
Lust ausgegangen, wurde der Asphalt zu Pflastersteinen, und ganz am
Ende, kurz, bevor die Felder begannen und der Weg einen Bogen ins Nichts
Richtung Birkenwäldchen machte, kam Schotter. Unser Haus war rot und
stand im Schotterteil der Straße. Parallel zum Birkenweg verlief eine
stillgelegte Eisenbahnstrecke. Wenn man aus der Haustür ging, über die
Schotterstraße, über den Bahndamm, und sich nach rechts, die Straße
hoch, wandte, kam man an den alten Bahnhof, der zu dem Zeitpunkt schon
ein Supermarkt war. Wenn man nach links ging, die Straße runter,
Richtung Felder, Richtung Birkenwäldchen, kam man an eine stillgelegte,
nur provisorisch eingezäunte Fabrik. Das war mein Schrottsammelrevier.
Ich weiß nicht, wie viel Schrott am Ende in dem Versteck im Wäldchen
lag, heute habe ich den Eindruck, es muss mindestens eine Tonne gewesen
sein. Ich wollte mit all dem Schrott nichts, ich schleppte ihn
kilometerweit, nicht, weil ich damit etwas bauen wollte, nicht, weil ich
irgendwas damit plante. An diese Geschichte musste ich denken, als ich –
über Facebook, natürlich – die Nachricht bekam, ich solle doch einen
Essay über Facebook schreiben.
Ich habe meine Schrottsammelleidenschaft nie abgelegt: Mein ganzer Computer ist voll mit Bildern, Texten, Videos, Musik, von denen ich glaube, es könnte später noch einmal nützlich sein, Bücher werfe ich prinzipiell nicht weg, meine Vinyl-Sammlung quillt über von Platten, die ich teilweise noch nie gehört habe, undsoweiter, und es wird immer mehr. Und ich zeige den Kram gerne her, wer mich besucht, kann ein Lied davon singen.
Das Herzeigen folgt aber einem anderen Mechanismus: Es passt für diesen
Essay gut, dass das Yps-Heft jetzt eine eigene Facebook-Fanseite hat,
sonst hätte ich wohl nie mehr daran gedacht. Die Fanseite selbst ist
eigentlich nicht der Rede wert, mal werden da kollektive Erinnerungen an
die Urzeit-Krebse oder ähnliches aktiviert, mal gibt es Vorakündigungen
zum neuesten Reanimationsversuch der Hefte. Im großen und ganzen nimmt
die Yps-Fanseite aber keinen herausragenden Platz im Nachrichtenstream
ein. Es geht um etwas anderes, persönlicheres. Die Geschichte der
Yps-Hefte ist eine, die man persönlich erzählen muss, man kommt nicht
drumrum. Damals, als ich noch in der Yps-Zielgruppe - präpubertierende
Jungs kurz vor Bravo – war, interessierten mich Gimmicks für zuhause
eher wenig. Die Urzeitkrebse beispielsweise waren zwar faszinierend,
aber mir gefiel die Klebe-Hand viel besser. Nicht nur, weil sie ganz
wunderbare Fettflecken an die Wand machte, sondern, weil man sie mit in die Schule
nehmen und herzeigen konnte.
Fettflecken an die Wand machte, sondern, weil man sie mit in die Schule
nehmen und herzeigen konnte.
Als ich 2006 einen Blog einrichtete, verwechselte ich Gimmicks mit Schrott: Ich hielt das, was ich da zu sagen hatte, für relevant, und mein einziges inhaltliches Auswahlkriterium war: Zeug, das mich gerade interessiert. Ich bemühte mich, das alles in klassische Fomen zu pressen: Rezensionen, Reportagen, solche Dinge.
Die Idee, dass mein Blog als Archiv zum Selbstzweck existieren könnte wie mein Schrottplatz in dem Birkenwäldchen, kam mir nicht. Ich zeigte nur das coole Zeug her, ich traf eine Auswahl aus dem, was ich auf meinen Streifzügen durch meine Schrottsammelreviere entdeckte. Der Rest wurde entweder vergessen, oder landete in einem privaten Archiv. Der Blog war die Auslese. Natürlich hätte mein Blog auch als Archiv dienen können, aber es sollte nicht nur als Archiv dienen. Solche toten Archive habe und hatte ich genug. Ich wollte etwas lebendiges, etwas mit Austausch, ich wollte nicht einfach nur ein multimediales Notizbuch, sondern ich wollte ein multimediales Notizbuch, das mir außerdem noch sagen konnte, ob das, was in ihm stand, auch wert war, in ihm zu stehen, das Ideen von selbst weiterentwickeln konnte. Ich wollte ein Notizbuch, das mir auf die Schulter klopfen kann, und eines, das zurückschlägt, wenn es sein muss.
Der endgültige Tod meines Blogs fiel mehr oder weniger mit meiner Entdeckung von Facebook zusammen: Einer der ersten Links, die ich postete war ein Blogeintrag, den ich – typisch - „Epitaph“ nannte.
Was ich von meinem Blog erwartete, konnte Facebook viel besser: Es bot nicht nur die Möglichkeit, nein, es wollte von Anfang an von mir, dass ich Schrott sammele und ihn herzeige, es fragte mich geradezu ununterbrochen, was ich gerade tue, und es machte mich auf die wunderbaren Features der immer präsenten Schrottsammelleiste aufmerksam. Es lädt dazu ein, alles, wirklich alles, zu posten, was man so findet, denkt, und tut.
In dem Birkenwäldchen damals konnte ich machen, was ich wollte, ich glaube, ich habe das Versteck noch nicht einmal meinem damals besten Freund gezeigt. Im Blog war es mir egal, ich wusste ja nicht, wer da mitliest. Auf Facebook gibt es keinen privaten Schrott. Facebook gibt sich zwar als Birkenwäldchen, aber es ist viel mehr wie die Schule, in die ich die Yps-Gimmicks mitnahm: Alle meine Freunde sind da, und bewerten, was ich tue und dabeihabe.
Und auch, wenn Facebook das Gegenteil behauptet, es geht erstmal gar nicht um die Inhalte: Bei allem, was ich dort tue, schwingt -vielleicht, das will ich gar nicht ausschließen, nur in meinem Kopf - immer das Bild mit, dass ich dabei von mir anlege. Bei dem das, was ich aktive an Notizen, Links und Fotos poste, nur ein kleiner Teil ist. Genauso wichtig sind Freundeslisten, das Profilbild, Gruppenmitgliedschaften, Kommentare, wann man bei wem den „Das gefällt mir“-Button klickt, usw., usf.: Alles, was ich tue, wird sofort ans gesamte Netzwerk übermittelt. So ist alles, was ich poste, nicht nur Schrottplatz, noch nicht einmal nur Gimmick, es ist gleichzeitig auch das, was ich von mir selbst durch die Paranoia-Maschine Facebook lasse.
Hätte damals mein Birkenwäldchen Besucher gehabt, ich weiß nicht, was ich getan hätte, ich vermute, ich hätte es inszeniert, auf irgendeine Art, und vor allem hätte ich geleugnet, dass es letztendlich keinem Zweck diente außer sich selbst.
Mir geht es nicht darum, meine Freunde darüber zu informieren, was ich tue, oder darum, ihnen zu zeigen, was ich gefunden habe, was ich gerade mag oder nicht mag. Es geht auch nur in einem geringen Maße um Selbstinszenierung. Es geht eher um so etwas wie Selbstaufbereitung, darum, mich auf eine Art anzulegen, die zwar etwas mit mir zu tun hat, gleichzeitig aber auch das Publikum befriedigt, oder wenigstens auf sein Interesse stößt. Im Laufe der Zeit sind diejenigen, die sich auf Facebook meine Freunde nennen, eher zu so etwas wie Publikum geworden, Publikum, dass mir bei meiner Selbstaufbereitung zuschaut, und sich darin einklinken kann, sogar soll: Wenn ich etwas poste, und niemand klickt auf „Das gefällt mir“ oder schreibt einen Kommentar, frage ich mich, ob ich etwas falsch gemacht habe, was genau das war, und ob ich den Fehler beim nächsten Mal vermeiden kann. Darum geht es mir auch, vor allem und speziell bei Facebook: Feedback. Ich nahm die Yps-Gimmicks auch ja auch nicht mit in die Schule, um plötzlich jemand anders zu sein. Ich nahm sie mit, um mir selbst etwas hinzuzufügen.
Was dann auch schon wieder, glaube ich, der Hintergedanke – bewusst oder unbewusst, sei mal dahingestellt - hinter all meinen Facebook-Posts wäre: Weder bin ich in ihnen jemand anders, noch versuche ich, ein Archiv meines Lebens, meine Lebenserzählung, dort festzuhalten. dafür ist das alles doch wieder zu ausgewählt, zu wenig ungefiltert.
Es geht mir vielmehr um eine Erzählung dessen, was ich mir selbst noch hinzufügen möchte, weder Fiktion noch Dokumentation, sondern einfach nur herausgeschnittene Szenen, wie das Bonusmaterial auf einer DVD, Ausschuss, zwar, aber solcher, von dem ich einerseits glaube, dass Leute ihn sehen wollen, aus welchen Gründen auch immer, von dem ich andererseits aber auch glaube, es könnte meinem Publikum etwas über mich erzählen, was sie sonst vielleicht nicht erzählt bekämen. Und von dem ich glaube, er könnte den Leuten etwas über mich erzählen, was ich ihnen gerne erzählen würde, das ist wichtig, glaube ich. Dass sie prinzipiell interessiert sind an dem, was ich zu sagen habe, an mir, vielleicht, setze ich voraus: Sonst wären sie ja nicht meine Freunde geworden.
So gesehen war Facebook nichts Neues für mich, es fügte nur den
Selbstaufbereitungsimpulsen, die ich sowieso schon immer hatte, – Schrott sammeln, Gimmicks zeigen – einen
neuen Verteiler hinzu, genau wie, wenn ich von Zeit zu Zeit DJ spiele,
es auch darum geht, Leuten das tolle Zeug vorzuführen, das ich gefunden
habe, genau wie es, wenn ich schreibe, darum geht, aus dem Schrott, den
ich gesammelt habe mit sorgfältigem Blick auf mein Publikum das Beste
herauszuholen: Es sind dieselben Sammeln-und-Zeigen-Mechanismen, und
Facebook ist ein Puzzlestein in dem, was ich produziere, der genau diese
Impulse bedient, etwas, mit dessen Hilfe ich das, was ich woanders auch
erzähle, wieder auf eine andere Art noch einmal erzählen kann, wie
Platten sammeln und abspielen oder diesen Essay zu schreiben auch
dieselbe Geschichte erzählt nur eben ein bisschen anders.
sowieso schon immer hatte, – Schrott sammeln, Gimmicks zeigen – einen
neuen Verteiler hinzu, genau wie, wenn ich von Zeit zu Zeit DJ spiele,
es auch darum geht, Leuten das tolle Zeug vorzuführen, das ich gefunden
habe, genau wie es, wenn ich schreibe, darum geht, aus dem Schrott, den
ich gesammelt habe mit sorgfältigem Blick auf mein Publikum das Beste
herauszuholen: Es sind dieselben Sammeln-und-Zeigen-Mechanismen, und
Facebook ist ein Puzzlestein in dem, was ich produziere, der genau diese
Impulse bedient, etwas, mit dessen Hilfe ich das, was ich woanders auch
erzähle, wieder auf eine andere Art noch einmal erzählen kann, wie
Platten sammeln und abspielen oder diesen Essay zu schreiben auch
dieselbe Geschichte erzählt nur eben ein bisschen anders.
Und das wäre es dann eigentlich: Selbst die Geschichte vom Anfang, die Geschichte des Schrottsammelns müsste ich jetzt noch enttarnen als eine vom Schrottsammelplatz, als einen Gedanken, eine Geschichte, die ich einmal gesammelt habe, und so lange im Birkenwäldchen gehortet, bis ich sie dem Publikum vorführen kann, bis sie Sinn macht in der Geschichte, die ich zu erzählen habe: Die wunderbare Geschichte, wie ich meinem Publikum den Schrott zeige, den ich gesammelt habe.
![]()
Obsessive Gefühle
Saskia Richter: "Die Aktivistin. Das Leben der Petra Kelly"
Von Tobias Hofer
 Ein
seltsamer Zufall. Da ist mein leitartikel-Thema natürlich Stuttgart;
nicht ein Bahnhof, nicht die Trauer um Bäume, sondern die Frage nach
dem, wem sie zum Opfer fallen. Stuttgart 21 ist ein Aufbegehren gegen
die einfach ignorierten Veränderungen, die sich aus der Finanzkrise
ergeben. Das beständige Bauchpinseln der Wirtschaftsbosse durch die
Politik, das verdächtig nah an Korruption operiert; finanziert allein
durch die braven Bürger, die nichts davon haben außer Angst um
Arbeitsplätze, Irrewerden an finanzpolitisch widersinnigen
Entscheidungen und dem Entsetzen über ein immer schrecklicheres
Erscheinungsbild ihres Lebensumfeldes – das ist die Gemengelage, die
Stuttgart 21 zu Sprengkraft verleiht.
Ein
seltsamer Zufall. Da ist mein leitartikel-Thema natürlich Stuttgart;
nicht ein Bahnhof, nicht die Trauer um Bäume, sondern die Frage nach
dem, wem sie zum Opfer fallen. Stuttgart 21 ist ein Aufbegehren gegen
die einfach ignorierten Veränderungen, die sich aus der Finanzkrise
ergeben. Das beständige Bauchpinseln der Wirtschaftsbosse durch die
Politik, das verdächtig nah an Korruption operiert; finanziert allein
durch die braven Bürger, die nichts davon haben außer Angst um
Arbeitsplätze, Irrewerden an finanzpolitisch widersinnigen
Entscheidungen und dem Entsetzen über ein immer schrecklicheres
Erscheinungsbild ihres Lebensumfeldes – das ist die Gemengelage, die
Stuttgart 21 zu Sprengkraft verleiht.
Aus der Öko-Bewegung kam ja schon einmal
der Kampf gegen politische Verkrustungen. Schon einmal war das große
Thema, wer eigentlich wen beherrscht, wer wen unterdrückt und warum.
Wenn man nach Spuren sucht, um über die möglichen Folgen von Stuttgart
21 nachzudenken, landet man bei einem Namen, den allen nach sagen wir
1985 Geborenen noch nie gehört haben: Petra Kelly. Einen jüngeren
Rezensenten dafür zu finden, ist ohne lange Erläuterungen unmöglich. So
fragt sich als erstes, warum jemand überhaupt ein Buch über Petra Kelly
schreibt – jemand, der kein Weggefährte aus den siebziger, achtziger
Jahren ist. Denn natürlich erhitzen die alten Kämpen sich bis heute über
Petra Kelly; die Linke, die Rechte, die Feministen, die Ökoradikalen.
Aber jüngere?
Saskia Richter hat das Buch über Petra Kelly geschrieben. Sie ist Jahrgang 1978 und arbeitet an der Zeppelin University in Friedrichshafen. Sie hat schon Bücher über gescheiterte Kanzlerkandidaten geschrieben und CSU-Kanzlerkandidaten. Die Funktionäre der Politik, ihr Thema.
Da kann man auch auf Petra Kelly kommen, eine derer, auf die die Grünen als politischen Faktor, als Bundestagsfraktion zurückgehen. Das ist auch Richters Stärke: Funktionen, Ämter, umrissene Tätigkeiten, Strukturen, die einem helfen oder einem im Weg stehen – so analysiert sie Kellys Leben. Das politische Bonn und die organisatorische Geburt der Grünen, das schildert die Autorin anschaulich und strukturiert. Die großen Leistungen von Petra Kelly, die bis heute nachwirken – eine Öffentlichkeit für Tibet zu gewinnen (Kelly ist mit dem Dalai Lama befreundet gewesen)! die Gleichberechtigung von Mann und Frau! -, werden endlich klar herausgearbeitet.
Als Biographie fällt dieses Buch eigentümlich mit seinem Thema zusammen. Durch eine wie Petra Kelly kamen Gefühle, kamen Privatheiten in die Politik; man durfte Mensch mit Schwächen sein. Erst die bleierne Kohl-Zeit hat das den jungen Leuten wieder gründlich ausgetrieben. Man hatte wieder Leistung zu bringen; aus! Saskia Richter erzählt viel von Petra Kellys Kindheit und Jugend, ihre Bewunderung für Mutter und Großmutter, die Nähe zu ihrer früh verstorbenen Halbschwester, die Anlehnung an den Stiefvater. Die Autorin analysiert die Verquickung von politischem Handeln und geradezu obsessivem Ausleben nicht-verkrafteter Gefühle durch Petra Kelly. Auch das war neuer Politikstil, die Konservativen haben ihn gehasst und tun es bis heute.
Saskia Richter jedoch deutet ihn ganz aus heutiger Sicht, wo ihm nichts Revolutionäres, sondern nur Verschwurbeltes anhaftet. Typisch für die in Journalismus und Wissenschaft verbreitete Perspektive ist auch die seltsame Amputation von Privatleben nach der Kindheit. Partnerschaft? Kinder? Kinderwunsch? Antrieb durch nie geborene Kinder? Starke Gefühle gibt es nur aus der eigenen Herkunftsfamilie. Wo der erwachsene Mensch mindestens genauso sehnsüchtig ist – nur darf es nicht sein. Dass dem so ist, daran hat auch Petra Kelly nichts geändert. Darum auch stand sie nach dem Ende ihrer politischen Karriere ohne jede Idee vom Leben da.
Uns fehlt heute erst recht die intellektuelle Konstitution, darüber offen und ehrlich zu sprechen und Kellys Tod –erschossen durch ihren Lebensgefährten, der sich anschließend selbst erschoss- schlüssig darzustellen. Harzig liest sich daher das Kapitel dazu.
Doch insgesamt: Die Autorin hat erfolgreich unter Beweis gestellt, wie erhellend es ist, wenn man Distanz halten kann. Treffend resümiert Richter: „In der Erinnerung scheint es, als gehöre Petra Kelly in eine andere Zeit, nicht in 1990er Jahre.“
Und was ist heute, mit uns, mittendrin in denselben Kämpfen wie Kelly damals?
Für Stuttgart 21 lässt sich aus dem Buch schließen, wie die politischen Würdenträger reagieren, wie die konservative Meinung und die grüne veröffentlichte Meinung reagieren. Doch nichts über die, die den Widerstand von unten schultern. „Die Aktivistin“ gibt ein Stück bundesrepublikanischer Polit-Identität zur Lektüre. Für das Geschichtsverständnis, das Historie durch Herrscher erzählt. Auch das ist nützlich.
Saskia Richter: Die Aktivistin. Das Leben der Petra Kelly
DVA 2010
528 Seiten, 24,99 Euro
ISBN 978-3421044679
![]()
Von Cay Meyer
 Die
Medien in Deutschland werden durch andere Wirkweisen als
Besitzverhältnisse - wie in Italien - staatsabhängig gemacht - durch einen Cocktail von Subventionen und Fördergeldern
werden sei erst süchtig und dann zur Ruhe gebracht. Da in der deutschen Parteienwelt
dort keine Wahlmöglichkeit bleibt, wo alle Parteien sich gleichermaßen
bedienen (wie beim Machterhalt durch gleichgeschalteten Journalismus),
ist das Umspringen mit den öffentlich-rechtlichen Sendern uferlos.
Die
Medien in Deutschland werden durch andere Wirkweisen als
Besitzverhältnisse - wie in Italien - staatsabhängig gemacht - durch einen Cocktail von Subventionen und Fördergeldern
werden sei erst süchtig und dann zur Ruhe gebracht. Da in der deutschen Parteienwelt
dort keine Wahlmöglichkeit bleibt, wo alle Parteien sich gleichermaßen
bedienen (wie beim Machterhalt durch gleichgeschalteten Journalismus),
ist das Umspringen mit den öffentlich-rechtlichen Sendern uferlos.
Die Kanzlerin in bester sozialistischer Tradition nutzt alles, was ihr nützt; sie kennt keine Grenze und keine Sachthemen. Verhasst sein und an der Macht bleiben, das sind die Koordinaten einer Kanzlerin, die ohne rot zu werden ihren Pressesprecher zum Intendanten des Bayerischen Rundfunks macht, die zu jedem Sportereignis lächelt und die sogar Kulturveranstaltungen instrumentalisiert.
Berlusconi hat es vorgemacht, wie man eine Diktatur im europademokratischen Gewand schafft, und Merkel hat die Ausstrahlung, es noch perfekter als er zu machen. Die wirtschaftliche Schwächung der Mehrheit der Bevölkerung, das Mundtotmachen des Bürgertums, die Zurschaustellung der Hilflosigkeit der Kulturschaffenden und die erwünschte "Mir egal"-Haltung der Reichen - das ist das System Merkel, mit dem sie sich allein oben hält. Nur Presse und Internet sind noch nicht gleichgeschaltet, Wir müssen damit rechnen, dass es ein Kampf mit harten Bandagen wird, deren Freiheit zu erhalten.
![]()
Von Tobias Hofer
Eine kleine „Elite“ von Staatschefs der
größten Wirtschaftsstaaten trifft sch. Die demokratische Legitimation:
bei vielen fraglich. Sie sind industrie- oder medienernannt. Der Reichtum dieser
großen 20 beruht auf verschiedenen Faktoren: Rohstoffen, die eigentlich
allen Ländern gehören müssten und Kolonialismus. Ihre Macht beruht auf Ausbeutung.
Ausbeutung.
Diese Staaten haben mit Hilfe eines Banken-Industriekomplexes ein kleines Weltvermögen verbrannt und damit kaum unter Beweis gestellt, dass der zu Unrecht erbeutete Reichtum tatsächlich von ihnen verwaltet werden könnte. Sie blasen sich auf und spielen Gönner und Verteiler.
Um die Löcher jetzt wieder zu stopfen, wird wieder das alte Schema in Gang gesetzt, der Rohstoff Ausbeutung, die Kolonialisierung und die Ressourcenaneignung. Das geht immer nur auf Kosten der Schwachen innerhalb des Volkes und der schwachen Nationen auf der Erde. Profiteure sind kleine Prozentsätze in den Industrieländern selber und Promille auf der Erde.
![]()
Ein weiterer Schritt hin zu einer korrupten Dual-Gesellschaft
Wozu das geplante Stipendiensystem führt
Von Cay Meyer
 Was ist Elitenbildung? Man bildet sie,
indem man seine eigenen Leute hochzüchtet. Das war nie anders (und nur,
wenn man vor jeder Diskussion frei definiert hätte, was Elite eigentlich
sein soll, könnte man dem Begriff jetzt vertrauen. Es ist nicht
geschehen.). Und so ist es jetzt auch geplant; ein Stipendiensystem soll
es geben, in dem besonders begabte Studenten gefördert werden. Die
Parteien und die Unternehmen werden darüber befinden, wer es zu bekommen
hat. Wer also Kontakte hat oder Geld, sich auf bestimmte
Notendurchschnitte zu hieven, der ist drin im System. Die anderen sind
außen vor. Aber das kennen sie ja von zuhause.
Was ist Elitenbildung? Man bildet sie,
indem man seine eigenen Leute hochzüchtet. Das war nie anders (und nur,
wenn man vor jeder Diskussion frei definiert hätte, was Elite eigentlich
sein soll, könnte man dem Begriff jetzt vertrauen. Es ist nicht
geschehen.). Und so ist es jetzt auch geplant; ein Stipendiensystem soll
es geben, in dem besonders begabte Studenten gefördert werden. Die
Parteien und die Unternehmen werden darüber befinden, wer es zu bekommen
hat. Wer also Kontakte hat oder Geld, sich auf bestimmte
Notendurchschnitte zu hieven, der ist drin im System. Die anderen sind
außen vor. Aber das kennen sie ja von zuhause.
Geld bringt Geld. Das alte Lied nun auch bei Stipendien. Es schmerzt: Wir haben ein funktionierendes Bafög, das man ausbauen könnte; freier gestalten, großzügiger vergeben; eben als Förderung einer positiven gesellschaftlichen Entwicklung verstehen. Es hat in sich die Chance zur Neutralität. Kein klientelistischer, parteilicher Verteilungsschlüssel, nichts für Typen mit den Gefälligkeitskontakten. Die geplanten Stipendien sind ein weiterer Schritt hin zu einer korrupten Dual-Gesellschaft, die irgendwann nur noch ein Oben und ein Oben kennt und keine Durchlässigkeit. Denn wer über das Geld bestimmt, der bestimmt auch über die Geister; der zahlt nicht für kritische Meinungen.
Die Stipendienpläne sind brandgefährlich; zerstörerisch für die Demokratie. Wer gegen sie aufstehen kann, der tue es. Die anderen müssen hoffen, dass die Koalition, die Derartiges im Schilde führt, im Staube untergeht. Verschwindet für alle Zeiten.
![]()
Soziale Kompetenz ist Betrügen, Lügen, Schwänzen
Für andere, nicht für sich
Von Cay Meyer
 Soziale
Kompetenz ist, wen wunderts, keine objektiv zu definierende Fähigkeit.
Politik und Wirtschaft tun nur so. Soziale Kompetenz ist Gummi mit
Weichmacher in ihren Händen, zu einer zischenden Peitsche zu formen, um
die jungen Verunsicherten und zukünftig abhängig Beschäftigten in die
passende Richtung zu prügeln.
Soziale
Kompetenz ist, wen wunderts, keine objektiv zu definierende Fähigkeit.
Politik und Wirtschaft tun nur so. Soziale Kompetenz ist Gummi mit
Weichmacher in ihren Händen, zu einer zischenden Peitsche zu formen, um
die jungen Verunsicherten und zukünftig abhängig Beschäftigten in die
passende Richtung zu prügeln.
Der Sicht der aufgeklärten Menschen widerspricht das Gerede der unsympathischen Emporkömmlinge sofort. Soziale Kompetenz ist schon in der Schule die Fähigkeit, sich mit Idioten, die nicht zu einem passen, in einen Raum zu pressen.
Soziale Inkompetenz hingegen ist es, Freunde zu finden, mit denen man gemeinsam gegen Lehrer und deren Macht opponieren kann. Für die man lügt und betrügt, die man abschreiben lässt, mit denen man in der Stadt rumhängt und Eis isst, statt sich in Mathe zu langweilen. Soziale Kompetenz ist es, egoman dem Wahn des unendlichen Geldverdienens und allein für sich Ausgebens hinterherzuhecheln, ohne seine Umgebung wahrzunehmen oder gar sich für sie Zeit zu nehmen, auf sie zu hören.
Soziale Inkompetenz ist Vertrauen haben, ist, von anderen Menschen nichts zu wollen, was einen selbst voranbringt.
Zu sozialer Kompetenz passen keine Kinder und kein Partner; man muss allein und stark voranschreiten, alles links liegen lassen, was schwach ist. Soziale Kompetenz ist, Kinder aus dem Straßenbild zu verbannen und Ältere und Kranke in Heime abzuschieben. Soziale Kompetenz ist es, Schwache zu hassen und ihnen jede Hilfe zu verweigern. Soziale Kompetenz ist in unserem System leicht zu erlangen. Zur Schule gehen, Master machen, eine arbeitsmarktkompatible weiße Westen haben.
Soziale Inkompetenz hingegen kann man nur durch Ringen mit den Staatswerten, mit subversivem Nein-Sagen-Können erlangen, mit dem Verzicht auf den eigenen Vorteil. Die Bewegung der sozial Inkompetenten, das ist das Tragikomische, ist letztlich die einzige Kraft, die ein Land tragen kann. Auch wenn sie ausgehungert werden soll: Ihr müsst weiter zittern vor den anderen, ihr sozial Kompetenten!
![]()
Erhellend, aufregend und doch seriös
"Iran ist anders. Hinter den Kulissen des Gottesstaates"
Von Tobias Hofer
 Es
ist nicht einfach, sich Informationen über den Iran zu beschaffen, wenn
sie aus erster Hand und unbelastet von Ideologien sein sollen. Mit "Iran
ist anders" liegt nun ein länderkundliches Sachbuch vor, das die
Erwartungen des anspruchsvollem Lesers mehr als übererfüllt. Die beiden
Autoren, Werner van Gent und Antonia Bertschinger, nähern sich ihrem
Thema kundig - und sie verzichten auf jedwede Art von Schnurren und
Anekdoten im Stil eines Scholl-Latour. Die ernsthafte Ausrichtung, der
Wille zum seriösen Informieren, auch über ein Land, bei dem Lücken im
Wissen bleiben müssen, durchzieht dieses Buch.
Es
ist nicht einfach, sich Informationen über den Iran zu beschaffen, wenn
sie aus erster Hand und unbelastet von Ideologien sein sollen. Mit "Iran
ist anders" liegt nun ein länderkundliches Sachbuch vor, das die
Erwartungen des anspruchsvollem Lesers mehr als übererfüllt. Die beiden
Autoren, Werner van Gent und Antonia Bertschinger, nähern sich ihrem
Thema kundig - und sie verzichten auf jedwede Art von Schnurren und
Anekdoten im Stil eines Scholl-Latour. Die ernsthafte Ausrichtung, der
Wille zum seriösen Informieren, auch über ein Land, bei dem Lücken im
Wissen bleiben müssen, durchzieht dieses Buch.
Neue Erkenntnisse, manchmal auch neue Gefühle stellen sich beim Lesen ein. Die fundierten historischen Einblicke lassen die Kolonialzeit und das -wirklich so bezeichnete- "Great Game" in dieser Region aufleben, zeigt die Folgen bis in die heutige Zeit - vor denen wir alle uns jetzt nicht wegducken können.
Die Wurzeln der Beziehungen des Westens zum Iran beginnen durchzuschimmern; die Schwierigkeiten auch, die der Iran mit den ehemaligen Ausbeutern bis heute hat. Wunderbar gelingt es den Autoren, Hintergründe aufzuzeigen, sie bis in die Gegenwart zu leiten und doch niemals die Menschen mit den Regierungen in einen Topf zu werfen. Das ist die Basis, auf der dem Leser das Land in seinen ganzen Facetten erklärt wird. Das Alltagsleben, das Überleben in der jetzigen Diktatur, dem kommt man ganz nahe.
Jeder, der sich mit dem Iran und der Region beschäftigen will, für den ist dieses Buch der richtige Weg mitten hinein. Wer de Chance hat, dort hin zu fahren, der sollte dieses Buch gelesen haben, weil es soviel erläutert - ich war vor ein paar Monaten im Iran und bin wirklich traurig, dieses Buch nicht gekannt zu haben. Ich habe mich auf Nachrichten verlassen, auf all das, was zugänglich ist, und in vielen Bereichen habe ich mich fehlinformiert gefühlt. "Iran ist anders" war für mich nun nicht nur Erkenntnis, sondern auch Programm.
Natürlich, Iranpolitik hat immer Zukunftsbezug. Alles, was man politisch jetzt verbricht, müssen die nächsten Generationen ausbaden. Was die Amerikaner bis in die 70ger Jahren getrieben haben, hat als Reaktion das, was heute die Konflikte ausmacht. Den westlichen Ländern ging es immer nur ums Öl. Das was von kritischen Köpfen gemutmaßt wurde, ist nach der Lektüre klar: Es ist eine Verlängerung des Spiels, das schon zur Kolonialzeit gespielt wurde. Öl ist Fluch und Segen, Zerstörung und Finanzquelle - wenn man durch Teheran geht, ist am erstaunt, wie hoch der Lebensstandard ist. Erklärungen eben auch für das "Tagesgeschäft" bekommt man durch dieses Buch.
Darüberhinaus ein kurzweiliges Buch! Kästchen mit Erläuterungen, Schlüsselstellen erzählerisch dargestellt, Klug durchdacht, und vor allem: Niemals wird man mit angeblichen Pseudoeigenheiten von Völkern belästigt, die Argumentation ist auf reale Ereignisse gestützt, nicht auf Schwammiges.
Einen Preis zahlt man für das hohe Analyseniveau. Ein wenig fehlt das Herzblut, das bei vielen Kennern der Region ja doch mitfließt angesichts der unglaublichen Gastfreundlichkeit der Iraner - was für ein tolles Land, was für tolle Menschen!
Man versteht die aktuelle Nachrichtenlage, die politischen Weichenstellungen um so vieles mehr durch dieses Buch. Es ist unbedingt lesenswert.
Antonia Bertschinger und Werner van Gent
„Iran ist anders: Hinter den Kulissen des Gottesstaates“
Rotpunktverlag 2010
270 S., Euro 24,00
ISBN 978-3858694157
![]()
Von Cay Meyer
 Albrecht
ist der Name, 90 das vermutete Alter, der Status: Einer der größten
Profiteure der Verarmung der Mittelschicht.
Albrecht
ist der Name, 90 das vermutete Alter, der Status: Einer der größten
Profiteure der Verarmung der Mittelschicht.
Zwei grundsätzliche Fragen drängen sich zu seiner Biographie: Warum ist es häufig so, dass, wenn man von unten kommt, dass man, anstatt sich seiner Wurzel zu ersinnen, zu einem grässlichen Ausbeuter wird? Warum vergessen viele von denen, die es dann nach oben schaffen, wie es sich unten anfühlt?
Die Väter haben noch ein Arbeiterleben führen müssen. Sie würden sich im Grabe umdrehen angesichts ihrer Söhne. Es taucht immer wieder auf, dieses Phänomen – nur, wer aus der kleinbürgerlichen Mitte kommt, ist deswegen nicht sozialer.
Die zweite Frage, die sich aufdrängt: Wie einer, der vermutlich 90 wird, ein richtiger Kapitalist, der seine Arbeitnehmer aushorcht, aber für sich in Anspruch nimmt, dass keiner etwas über ihn erfährt.
Bei dem Aldi-Thema geht es nicht um ein günstiges Produkt,
das für den kleinen
Mann erschwinglich ist, sondern darum, dass die Aldi-Besitzer
unermesslichen Reichtum angesammelt haben - nicht durch eine geniale Idee, sondern
durch Kostensenken, Kostensenken, Kostensenken. Dass die Menschen ganz unten unwürdigst
bezahlt, unwürdigst überwacht, zu unwürdigsten Bedingungen arbeiten: Der Manchester–Kapitalismus
lebt, es ist der Aldi-Kapitalismus. Heutzutage werden die Mütter nicht in die
Bergwerke gesteckt, sie landen hinter den Kassen der Discounter.

Aldi lebt von dem Abstieg der Menge, Hartz IV ist für Aldi ein Sieg, komplett alle Hartz IV-Gelde fließen in Richtung Aldi..
Aldi braucht keine Parteispenden zu leisten, braucht sich keiner Steuergelder zu bemächtigen. Aldi lebt von den Sozialtransfers.
![]()
Zeugnisse bezwingen Zivis. Erinnerungen an Reichsarbeitsdienst.
Von Cay Meyer
 Zivis
bekommen ab jetzt Zeugnisse, in denen ihre Leistung beim Zivildienst
festgehalten und bewertet wird, damit sie für Bewerbungen Unterlagen in
der Hand haben. Ihre
erworbenen Fähigkeiten werden so gewürdigt und für das Beruflebens
nutzbar gemacht – so die offizielle Darstellung.
Zivis
bekommen ab jetzt Zeugnisse, in denen ihre Leistung beim Zivildienst
festgehalten und bewertet wird, damit sie für Bewerbungen Unterlagen in
der Hand haben. Ihre
erworbenen Fähigkeiten werden so gewürdigt und für das Beruflebens
nutzbar gemacht – so die offizielle Darstellung.
Ganz anders die wahren Hintergründe.
Wenn ein Mensch einen anderen zwingt, irgendetwas zu tun, und zwar zwingt unter der Androhung, den anderen in einen finsteren Keller zu sperren über Monate, wenn er nicht etwas Bestimmtes tut und dann auch noch die Arbeit, die unter Zwang abgeleistet wird, bewerten will, dann ist der Zivildienst endgültig als demokratieunwürdiger Arbeitsdienst enttarnt.
Ein Zwangsdienst wird benotet! Damit schwindet die letzte Freiheit, die letzte Antwort des einzelnen.
Ich tue es, weil ich gezwungen werde, aber ich tue es, wie ich es will. Zwang mit Zeugnis? Schizophren. Oder doch mehr?
Wozu dient das Zeugnis überhaupt? Über kurz oder lang wird der Zivildienst den Realitäten genauso zum Opfer fallen wie der Wehrdienst. Beides wird aufgehoben werden müssen. Ohne Soldaten, okay. Aber ohne Zivis? Das würde teuer werden. Der Zivi fehlt an jeder Stelle. (Obwohl er eigentlich nicht fehlen dürfte, da er ja keine echte Stelle besetzen kann.)
Es geht seit Jahren nur um die billige Altenbetreuung. Also wird ein soziales Jahr für alle eingeführt. Freiwillig, weil man dazu nicht zwingen kann – aber mit dem Zeugnis hat man eine Grundlage in der Hand, die man benutzen kann als Zugangsbeschränkung für das weitere Leben. Das freiwillige soziale Jahr wird als Zugangssystem zum Zwang. Es wird dort, wo Staat und Altengesellschaft können, nachgefragt werden – für die Uni, für soziale Leistungen, die man in Anspruch nehmen will. Lebensdiktatur durch die Hintertür.

![]()
Gut, Kommunalpolitik ist spießig.
Aber wenn sie dann auch noch verfassungsfeindlich ist.
Von Tobias Hofer
 Es
funktioniert ganz einfach:
Es
funktioniert ganz einfach:
Bund gibt Gelder, die Länder stimmen zu, weil sie was bekommen wollen, und die Kommunen müssen sparen, weil Bund und Länder ihrer verfassungsmäßig vorgesehenen Überwachung nicht mehr nachkommen.
Parteientotalitarismus.
Es gibt Kanzler und Bundestag, die haben zu entscheiden, und dann müssen die Länder im Bundesrat zustimmen, ob ihnen als Bundesland für sie möglich ist. So müsste es sein. Ist es aber nicht.
Hier findet sich auf hoher politischer Ebenes ein täglicher Bruch des Grundgedankens der Bundesrepublik statt.
Ein allgemeines Beispiel: Wenn die FDP klientelistisch, korrupt und ihre Wählerschaft bedienend das Geld ausgibt, dann muss ein Bundesland dieses ablehnen können. Wenn aber der Bundesrat zu einem Parteienabnickverein geworden ist, verhindert das die nötige Kontrolle.
Das kleinste Glied, in diesem Fall die Kommune, muss das bezahlen und fängt an sich zu wehren.
Wìe?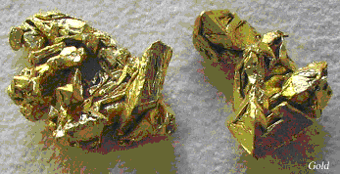
Die Möglichkeiten sind gering. Die Kommune muss das Geld eintreiben. Sie muss es von der Bevölkerung irgendwie holen. Aus dem, worüber sie herrschen: Müll, Wasser, Grund, Gewerbe. Das, was oben ausgegeben wird, wird auf keiner Ebene eingespart, sondern direkt auf die Bevölkerung umgeleitet. Meistens haben die Kommunen einer der Verbrauchssteuer ähnliches System. Pro Kopf-Einheiten, Zusammenklauberei. Dort wird die Armut der Familien gezimmert.
Gegen Kinder, gegen Studenten, gegen sozialen Ausgleich, gegen Freiheit. Weil irgendwann das Dasein in der untersten Ordnungsebene des Staates so teuer ist, dass man nicht mehr einen Tag einfach nur von Luft und Liebe leben kann.
![]()
Am Morgen gings uns dreckig
Kopfpauschalisten und Rosinenpicker
Von Cay Meyer
 Wir
hatten Brüdertreffen. Drei Studenten, wir in meiner Wohnung, und wir
hatten uns bis morgens etwas zu erzählen. Es war viel passiert in den
letzten Monaten, und die Hochstimmung, sich nicht verheizen lassen zu
wollen, war ein sehr guter Start in den Abend gewesen.
Wir
hatten Brüdertreffen. Drei Studenten, wir in meiner Wohnung, und wir
hatten uns bis morgens etwas zu erzählen. Es war viel passiert in den
letzten Monaten, und die Hochstimmung, sich nicht verheizen lassen zu
wollen, war ein sehr guter Start in den Abend gewesen.
Am Morgen gings uns dreckig. Da meldete das Radio die Kopfpauschale. Mein ein Jahr jüngere Bruder wagte es, mit der Faust auf den Tisch zu hauen. Das war lässig, und alles schwappte über. Auf den ersten Blick könnte man dahinter einen Sinn sehen! rief er. Man könnte denken ein Mann, ein Kopf, ein Preis. Es gibt genug Gerechtigkeitsthesen wo das Bestand hätte. Mein älterer Bruder sagte: Thatcher, die die britische Gesellschaft zu einer riesigen Unterschicht verarbeitet hat, die hat die Kopfpauschale eingeführt, bei den Steuern.
Wir schwiegen kurz. Bei uns soll also im Gesundheitswesen die
Kopfpauschale eingeführt werden. Das haben sich die Liberalen
ausgedacht, weil Einkommensunterschiede nicht im Gesundheitswesen
ausgefochten werden sollen.

Die Kopfpauschale lässt also jeden allein dastehen. Wer das für Kranke möchte, weil es für seine Klientel so attraktiv ist, der möge das bitte auch für Alte wollen, auch wenn das für die Klientel gar nicht mehr so nett ist. Die Liberalen machen nichts anderes als Rosinenpicken bei der Kopfpauschale. Wer gut verdient und Single ist, der hat was von seiner Wirtschaftspartei, die nicht rechnet: Er hat die Duplizierungsrate verfehlt, er müsste zwei Kinder für seine Altersversorgung großgezogen haben. Hat er aber nicht, deshalb müsste er jeder Mutter, die mehr als zwei Kinder allein großgezogen hat –oder fünf mit Mann- eine Kopfpauschale abtreten für die Rente.
Leider hören die liberalen Parteigänger das Rechnen schnell auf, wenn es um ihr Portemonaie gehen könnte. Beim Alter, da soll es Solidarität geben. Dabei funktioniert das Gesundheitswesen noch besser als das Rentensystem, bei dem die Liberalen von der Freiheit des einzelnen nicht viel hören lassen. Von der wirtschaftlichen Freiheit des Individuums würden wir auch gern mehr hören, besonders davon, we die wenigen gutverdienenden Karrieristen ohne die weiter verarmenden Familien, die ihnen dieses Leben erst ermöglichen (wir wussten schon immer, dass die Armut der einen der Reichtum der anderen ist, seit den Finanzströmen, die den Sozialschmarotzern in Anzug und Krawatte zufließen, wissen wir es erst recht.) Die Armen müssen natürlich immer ärmer werden, damit die Reichen auch in diesen Zeiten reich bleiben. Das ist die Idee hinter der Kopfpauschale. Darum die Abkehr vom Solidaritätsprinzip.
Um in der Sprache des Gegners zu bleiben: Der Standortvorteil Deutschlands hat auch etwas mit dem sozialen Frieden zu tun. Eine Wirtschaft wird nicht gezogen von den Managern, sondern von den Leuten, die ihnen das System ermöglichen, in dem sie wirtschaften können. Die Kopfpauschale im Gesundheitswesen ist eine Kampfansage an die, ohne die es nicht geht.
Meine Brüder und ich, wir haben fertig gefrühstückt. Heute fahren wir nach Hause, alle zusammen, und freuen uns auf unserer Eltern, die uns zur Zeit besonders gut finden, weil wir uns nicht verheizen lassen.
![]()
Die kurzen, knackigen David Lynch Momente des Lebens
Alles ist Projekt, alles Provisorium: Die aktuellen Studentenproteste sind nur der Kopf der Bestie
Von Jan Fischer
 Vor
ein paar Tagen saß meine Mitbewohnerin L. weinend am Küchentisch. Sie
hatte einen dieser kurzen, knackigen David- Lynch-Momente. Einer dieser
Momente, in denen alles sich neu sortiert. L. ist Teil einer Generation,
die sich selbst den Namen „Prekariat“ gegeben hat, eine Generation, die
in einem ständigen Provisorium lebt.
Vor
ein paar Tagen saß meine Mitbewohnerin L. weinend am Küchentisch. Sie
hatte einen dieser kurzen, knackigen David- Lynch-Momente. Einer dieser
Momente, in denen alles sich neu sortiert. L. ist Teil einer Generation,
die sich selbst den Namen „Prekariat“ gegeben hat, eine Generation, die
in einem ständigen Provisorium lebt.
Gleichzeitig ist an unserer Universität der Hörsaal eins besetzt. L. interessiert sich nicht groß dafür: Die Politikprojekte waren nie ihrs, obwohl sie eine gewisse Zuneigung zu allen Arten von Besetzung, seien es Häuser oder Hörsäle, nicht leugnen kann. Gleichzeitig tut es ihr weh, und zwar richtig, jedes Semester die Studiengebühren vom Konto verschwinden zu sehen, Schmerz, den sie alleine fühlt, vor dem Computer, beim Onlinebanking.
Ein Professor unserer Universität sagte, er käme sich im Moment so vor, als sei er nur noch eine „Bachelordurchschleusmaschine“. Man muss das vielleicht einmal feststellen: Den Universitäten geht es nicht gut, und jeder protestiert auf seine Weise, in einer Generation, in der Arbeit, Liebe, Freizeit oder Politik letztendlich nur zeitlich begrenzte Projekte sind, die zusammengenommen ein viel größeres Projekt ergeben: Das Lebensprojekt. L.’s Problem war, dass das Arbeitsprojekt sich mit einem Liebesprojekt überlappte, das Freundesprojekt verlangte Aufmerksamkeit, die das Freizeitprojekt gerade nicht hergab. Das fragile Arrangement ihres Lebensentwurfes war ins Wabern geraten. „Die Zeitschrift Neon ist das Zentralorgan dieser Generation“, analysierte die „Tempo“ in ihrer Jubiläumsausgabe, und „die Lounge ist ein Dauerzustand, alle sind irgendwie kritisch, aber auch irgendwie angepasst“. Die „Tempo“ nannte das Phänomen „Eigentlichkeit“.
Nach dem Label „Prekariat“ bekamen verschiedene Ausformungen noch wohlklingende Namen wie „Urbane Penner“, „Digitale Boheme“. Das Ganze hatte etwas mit Latte Macchiato zu tun und war also ungefährlich.
Die aktuellen Studentenproteste zeigen etwas, was die Beobachter bis jetzt vergessen haben, nämich dass die Eigentlichkeit nur die menschliche Komponente des Prekariates ist. Die bestialische Komponente blieb weitgehend unbeachtet. Folgt man Google, so ist die berühmteste Bestie die „Bestie von Gévaudan“, die zwischen 1764 und 1767 in Südfrankreich rund hundert Menschen tötete. Zugegeben, dabei handelte es sich mutmaßlich um einen Wolf.
 Den zweiten Google-Treffer belegt ein Buch namens „Bestie Mensch“ von
Thomas Müller, österreichischer Gerichtsmediziner. Das Buch handelt von
seinen ekelhaftesten Fällen. Bestien und Mörder werden ohne Zögern
gleichgesetzt. Das Label „Bestie“ ist zwar beängstigend, ein Tier ist
unberechenbar und gefährlich. Andererseits aber ist es auch beruhigend:
Dies sind Bestien, ich bin es nicht. Die Bestie ist mit dem Wort
bezwungen. Thomas Müller zitiert George Bernhard Shaw, der sagt, dass
jeder Mensch zum Mörder werden kann, also auch jeder Mensch zur Bestie,
und sei es nur für den Moment des Mordes selbst, den irrationalen
Augenblick, der den Menschen zum Tier macht: Die kurzen, knackigen
David-Lynch-Momente.
Den zweiten Google-Treffer belegt ein Buch namens „Bestie Mensch“ von
Thomas Müller, österreichischer Gerichtsmediziner. Das Buch handelt von
seinen ekelhaftesten Fällen. Bestien und Mörder werden ohne Zögern
gleichgesetzt. Das Label „Bestie“ ist zwar beängstigend, ein Tier ist
unberechenbar und gefährlich. Andererseits aber ist es auch beruhigend:
Dies sind Bestien, ich bin es nicht. Die Bestie ist mit dem Wort
bezwungen. Thomas Müller zitiert George Bernhard Shaw, der sagt, dass
jeder Mensch zum Mörder werden kann, also auch jeder Mensch zur Bestie,
und sei es nur für den Moment des Mordes selbst, den irrationalen
Augenblick, der den Menschen zum Tier macht: Die kurzen, knackigen
David-Lynch-Momente.
Und die sind häufig in einer Generation, die im Provisorium lebt: Wenn die eigene Existenz ständig gefährdet ist, wird alles, was man tut, zu einem politisch aufgeladenen Akt. Dafür muss man sich noch nicht einmal engagieren, noch nicht einmal zu denen gehören, die gerade im Hörsaal eins mit Schlafsäcken die Stellung halten. Wenn man nicht mitmachen kann, weil man einen Nebenjob hat, bei dem man es sich nicht erlauben kann fernzubleiben, weil man sonst die Studiengebühren nicht zahlen könnte, ist dann das Fernbleiben von Protesten nicht genauso politisch wie das Erscheinen?
Bestie ist ein Label für alles, was unberechenbar, kraftvoll und gefährlich ist. Das Prekariat befindet sich noch nicht in dieser extremen Variante der Bestialität, eher in einer Vorstufe: Noch hat sich die Bestie nicht gezeigt. Was George Bernhard Shaw auch meint, ist, dass die Bestie in jedem von uns verborgen ist und nur auf die richtigen Umstände wartet zu erscheinen. Beim Prekariat hat es den Anschein, als würde dieser Moment nie kommen: Eine breite Basis, die weder Geld hat noch Zukunft, sich von Provisorium zu Provisorium hangelt, genug Gründe für einen Befreiungsschlag oder wenigstens ein paar ernstgemeinte Forderungen an die Verantwortlichen. Dabei ist genau das schon die bestialische Ausformung.
Wenn die „Tempo“ sagt, dass das Prekariat aus „Jeinsagern“ besteht, ist das ähnlich wie die Behauptung, Pop der 80er wäre unpolitisch. Stimmt schon, hat aber Gründe. Genau wie die Musik der 80er durch die Abwesenheit von Politik ein politisches Statement machte, ist die „Eigentlichkeit“ nichts als eine Verteidigungsstrategie gegenüber einer Welt, die dem Prekariat aus den Medien bekannt ist. Es weiß, dass Protest, Politik nicht viel bringen, dass Aufstände zum Scheitern verurteilt sind. Die Proteste werden nicht andauern. Selbst in Frankreich halfen die brennenden Autos der Situation der Praktikanten nicht viel weiter.
Das ist nicht die Stärke des Prekariats. Es hat ausreichend ferngesehen um zu wissen, dass man mit den fifteen minutes of fame nicht viel erreicht. Es ist gerade die „Eigentlichkeit“, welche die Stärke des Prekariates ausmacht: Anpassen. Erdulden. Lächeln. Trotz widriger Umstände immer irgendwo Geld für den Latte herbekommen. Das Prekariat ist eine Masse, die gelernt hat, sich an der Basis der Gesellschaft elegant zu bewegen. Die sich durchlaviert und so angepasst ist, dass sie überall sitzt, überall ihre Praktikanten, Start-Upper, Kulturarbeiter und Laptop-Caféhäusler hat, eine Massenbewegung, welche die Entscheidungsstellen schon längst von unten infiltriert hat. Eine Generation, die mit dem Computer geboren wurde, die sich so gut in der Medienwelt auskennt, die sich so traumwandlerisch sicher im Internet bewegt, dass sie ihre Stärke hinter selbstgeschaffenen medialen Etiketten verstecken kann. Eine Generation, die sich langsam, aber sicher ihrer eigenen Existenz bewusst wird und begreift, dass irgendwas schief läuft. Die aktuellen Studentenproteste sind dafür nur ein kleines Sympton, welches nur kurz einmal zeigt, dass da plötzlich etwas passiert.
Wie die Bestie aussieht, wenn sie ihre Zähne zeigt, weiß man immer erst im letzten Drittel des Films. Bis dahin sind ihre wichtigsten Fähigkeiten Geduld und Tarnung. Die Bestie zeigt sich erst, wenn es zu spät ist. Der David-Lynch- Moment. Das haben wir von Hollywood gelernt, und wir warten darauf.
Am nächsten Tag lächelte L. übrigens wieder. Jemand Nettes aus dem Freizeitprojekt hatte es ins Liebesprojekt geschafft.
![]()
Also erstmal im Bett bleiben. Gerontokratie.
Von Cay Meyer
 Wenn
Lena morgens aufwacht, ist sie erstmal glücklich. Sie kann im Bett
bleiben. Denn sie hat seit einem Jahr Abi, und sie ist ziemlich froh,
aus der Schule rauszusein. Das wichtigste, was man in der Schule lernt
und nur in der Schule lernt: Dass man einen ganzen Tag mit Typen, mit
denen man die Luft in einem Raum nicht atmen kann, in einem Raum die
Luft atmet. Das macht mein Leben erst möglich, sagt Lenas Vater, der
Großraumbüro-Angestellte. Lenas Mutter sagt, nun bleib mal erstmal im
Bett. Aufstehen musst Du noch Dein ganzes Leben.
Wenn
Lena morgens aufwacht, ist sie erstmal glücklich. Sie kann im Bett
bleiben. Denn sie hat seit einem Jahr Abi, und sie ist ziemlich froh,
aus der Schule rauszusein. Das wichtigste, was man in der Schule lernt
und nur in der Schule lernt: Dass man einen ganzen Tag mit Typen, mit
denen man die Luft in einem Raum nicht atmen kann, in einem Raum die
Luft atmet. Das macht mein Leben erst möglich, sagt Lenas Vater, der
Großraumbüro-Angestellte. Lenas Mutter sagt, nun bleib mal erstmal im
Bett. Aufstehen musst Du noch Dein ganzes Leben.
Lena weiß, dass ihre Eltern recht haben, beide. Deshalb ist sie so froh, die Schule hinter sich zu haben.
Aber Lena lebt in einem Staat, der einen Haufen Schulden hat. Er hat sich bei Leuten mit Geld viel Geld geliehen. Nicht bei Lenas Eltern. Denen wäre ein Bankencrash egal gewesen. Sie sind keine Desperados, für sie ist es okay durchzukommen und in der Sonne einen Kaffee zu trinken, aber Geld auf irgendeinem Konto haben sie eben auch nicht. Sie zahlen Steuern, damit ein Immobilienmarkt mit Infusionen am Leben erhalten bleibt, der ihnen wiederum in Leerstandshausen überteuerte Mieten beschert, sagen ihre Eltern. Lena weiß das. Die hat eine Schule durchlaufen, hinter der kein neutral-verwaltender Staat, sondern ein Staat, der ungeduldig mit den Füßen schart, weil die jungen Generationen Tempo machen sollen, um schnell ins Berufsleben zu gehen, um schnell Schuldenabzahler zu werden. Eine Vergangenheit soll abbezahlt werden: Ein gutes Leben, in dem sich die Studenten viel Zeit gelassen haben, vielleicht zu viel Zeit für ihr gutes Leben, da hat sich ein Defizit aufgetan. Für Lena hat dieser Staat einige Gesichter. Sie strahlen Gutverdienendes aus. Die möchten sich ausnehmen aus dieser Schuldenmühle, darum kämpfen sie. Einfach selber gut durchkommen, bevor sie ins Gras beißen. Alles, was das verhindern könnte, nervt.
So ist sogar Familienleben subversiv geworden. Dort hat man Zeit füreinander, man könnte sich zuhören, Bedürfnisse wie Ruhe, Harmonie, nutzlose Ideen, sinnlose Phantastereien, Denken um des Denkens willen. Das wäre zu viel gefährlicher Individualismus, weil er nicht monetär zu berechnen ist; und nur das ist erlaubter Individualismus in einer staatskapitalistischen Welt.
Der
herkunftslose Mensch ist nun auch ein Traum der Konservativen geworden.
Hatten die Linke einst von ihm geträumt, um die Gesellschaft zu
verändern, träumen die anderen ideologischen Strömungen nun davon, um
nichts verändern zu müssen. Das scheußliche Bürgertum hatte früher eine
gewisse Bildung und ein gewisses Geld. Heute hat sich beides voneinander
abgetrennt. Viele Eltern, es sind die gebildeteren, sind damit
beschäftigt, die Familie durchzubringen und mit ihren Kindern die
kleinste soziale Zelle leben. Jeder, der da reinregiert, ist ein
Störenfried, und der heißt nach der Zwangsschule Studiengebühr. Die
Eltern sind auf Seiten der Kinder; die Politiker sowieso mental
kinderlos.
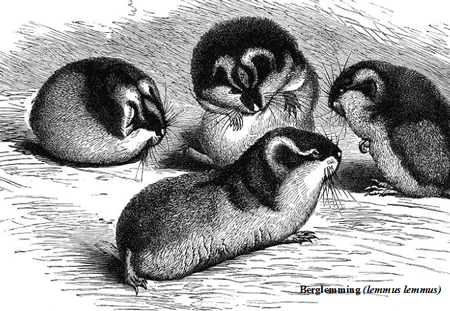
Sie hassen junge Leute. Für sie sind das verweichlichte Computerkids, denen die Hammelbeine langgezogen gehören. Die unter Dauerstress gesetzt werden müssen, die aus dem Straßenbild zu verschwinden haben, deren Bulimie und deren Killerspiele niemals auf den gesellschaftlichen Grund gegangen werden darf, die ins soziale Pflichtjahr – das kommt sicher, zur Not über die Bindung an Studienzulassungen – gesteckt werden sollen, die kurzstudieren sollen, ohne Aussicht auf Bildung und Selbsterfüllung, Berufsdienst ableisten gleich einem Wehrdienst, von jedem Klarblick abgehalten: Lemminge.
Natürlich stürzen die dann auch in den Abgrund und ertrinken im Burn-out-Meer der Zuträgerberufe. Es steht schwarz auf weiß in den Bilanzen: Mit Bankern, Managern, Ingenieuren allein lässt sich kein Staat machen, nicht einmal eine Ökonomie.
Die Utopie lautet heute Schuldenabzahlen. Eine Utopie, so kalt wie alle Utopien, die irgendwann Wirklichkeit geworden sind. Das Strohfeuer, das ein Frierender entzündet: Die Jüngeren werden kurz abgefackelt, damit sie nicht denken in der Zins- und Zinseszinsableistungsmühle.
Jung sein, das begönne dann erst mit 30. Dagegen muss man aufstehen. Oder im Bett bleiben, wie Lena.
copyright by librithek
