.gif)
das literarische nachrichtenmagazin
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Weihnachtshorror im Möbelhaus
Markus Heitz: "Der Tannenbaum des Todes. Mehr als 24 schwarzhumorige Weihnachtsgeschichten"
Von Anne Spitzner
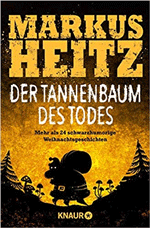 Bestsellerautor
Markus Heitz („Die Zwerge“, „Ulldart“) nimmt den mehr oder weniger
weihnachtsgestimmten Leser in seiner neuen Anthologie „Der Tannenbaum
des Todes“ mit in eine etwas andere Weihnachtswelt: Bizarr,
haarsträubend, mit krimineller Energie aufgeladen und doch von
irgendetwas erfüllt, das man nicht anders nennen kann als „Geist der
Weihnacht“ – denn Einkaufschaos, Familienzwist und schräge Vögel gehören
ja irgendwie auch dazu.
Bestsellerautor
Markus Heitz („Die Zwerge“, „Ulldart“) nimmt den mehr oder weniger
weihnachtsgestimmten Leser in seiner neuen Anthologie „Der Tannenbaum
des Todes“ mit in eine etwas andere Weihnachtswelt: Bizarr,
haarsträubend, mit krimineller Energie aufgeladen und doch von
irgendetwas erfüllt, das man nicht anders nennen kann als „Geist der
Weihnacht“ – denn Einkaufschaos, Familienzwist und schräge Vögel gehören
ja irgendwie auch dazu.
Die Weihnachtsgeschichten in diesem Band beruhen auf einer Weihnachtsveranstaltung, die Heitz jedes Jahr im Wirtshaus „Zum Alten Bahnhof“ in Zweibrücken anbietet, unter dem Titel „Böser die Glocken“. Eine Menüauswahl aus den vergangenen zehn Jahren wird übrigens angeboten, jedoch ohne Rezepte, stattdessen zum Auswürfeln. Ein nettes kleines Augenzwinkern in Richtung der Rollenspielfans, und natürlich eine gute Möglichkeit, die Küchengeheimnisse zu wahren.
Inhaltlich ist in „Der Tannenbaum des Todes“ dann so ziemlich alles dabei, was nur irgendwie mit Weihnachten zu tun hat. Die titelgebende Geschichte (der Titel geht noch weiter: „Der Tannenbaum des Todes, des Verderbens und der Finsternis“) beispielsweise erzählt von einem Speditionsfahrer, der den größten Tannenbaum aller Zeiten zu seinem Bestimmungsort bringen soll – unterwegs liest er jedoch einen Anhalter auf, und dann geht (großartige Hommage an Stenkelfeld) so ziemlich alles schief, was schiefgehen kann.
In vielen Geschichten geht es um enttäuschte Erwartungen, auseinandergedriftete Beziehungen, problematische Geschenke – eben alles, was man an Weihnachten gern unter den Teppich kehren würde, was aber dann zwangsläufig immer doch darunter hervorkriecht. Oder eben aus dem Kamin fällt, wie in Heitz‘ Geschichte „Kaminproblem“, in der ein etwas in die Jahre gekommener und um die Mitte fülliger gewordener Ehemann zufällig herausfindet, wozu genau seine Ehefrau den großen Kamin in ihrem Haus einsetzt.
Mein persönliches Highlight war die Geschichte „Räumpflicht“, ebenfalls eine Hommage an Stenkelfeld, in welcher der „gut integrierte“ Ali P. um 20.47 Uhr noch damit beginnt, die Straße zu räumen, weil eben, wie ihm sein Nachbar immer und immer wieder versichert hat, in Deutschland bis 21 Uhr Räumpflicht herrscht – woraufhin die ganze Straße in einen guerillakriegsartigen Zustand übergeht und ein Chaos ohnegleichen losbricht.
In vielen der Geschichten lässt die Schlusspointe bis zum allerletzten Absatz auf sich warten, und so ging es zumindest mir so, dass ich zwar an manchen Stellen dachte, „das habe ich auch schon woanders so ähnlich gelesen“, dann aber noch überrascht wurde. Und erstaunlich bösartige Ideen hat Heitz auch, so in der Geschichte „Böse Gewürze“, in der eine stadtbekannte Lebkuchenbäckerin von den Gewürzen ihrer Backkunst belästigt zu Tode kommt, oder in „Weihnachtshorror im Möbelhaus“, in der sich zeigt, woher ein namentlich nicht genanntes, aber für viele Ös und lustige Namen berühmtes Möbelhaus seinen leckeren Erdbeerwackelpudding bekommt. Für Fantasy-Leser kommen übrigens zwar keine Zwerge, dafür aber mindestens ein Mal Vampire vor, jedoch geht es meistens „mit rechten Dingen“ zu – wenn auch alles andere als anständig.
Fazit: „Der Tannenbaum des Todes“ von Markus Heitz eignet sich großartig als Adventskalender für alle, die hin- und hergerissen sind und nicht richtig wissen, ob sie eigentlich Bock auf Weihnachten haben oder nicht – und erst recht für alle, denen die Festtagsstimmung zum Hals raushängt und die sich, wenn auch nur in Gedanken, mal abreagieren wollen. Geeignet ist er auch zur Einstimmung auf Familienfeiern, oder zum abends gemeinsam lesen und schräg finden und kaputtlachen. Ho ho ho!
Markus Heitz:
"Der Tannenbaum des Todes. Mehr als 24 schwarzhumorige Weihnachtsgeschichten"
Knaur 2019
272 Seiten, 10 Euro
ISBN 978-3426524343
![]()
Jenny Valentine: "Kaputte Suppe"
von Susan Müller
 Ein
Riesenverlust, wenn ein Familienmitglied seinen angestammten Platz als
Sohn und Bruder verlässt! Nicht, weil es diesen nicht mehr einnehmen
will, sondern weil es tödlich verunglückt. Schwer ist es nicht nur für
die Eltern zu ertragen, die das Kind verlieren, was sie bisher groß
gezogen und geliebt haben, mit ihm gelacht, geweint, gestritten und sich
versöhnt haben; kurz gesagt, wenn es vor einem geht. Genauso schwer
ertragbar ist es für die Geschwister, die jüngeren Mädchen, die in
diesem Fall ihren großen Bruder, teils ihr Vorbild, verlieren. Besonders
tragisch im Fall von Rowan, da sie diejenige ist, die sich von nun an
kümmern muss. Ihr großer Bruder Jack kommt von einem Ausflug nicht
zurück. Die Mutter kann es so schlecht verkraften, dass sie dabei die
beiden lebenden Kinder Rowan und Stroma vergisst und sich komplett
abschottet. Darüber zerbricht auch der Vater und die Ehe, denn neben
seinem Sohn ebenfalls die Frau zu verlieren, ist mehr als wiederum er verkraften
kann. Seine Töchter lügen ihm allerdings über den Gesundheitszustand der
Mutter etwas vor.
Ein
Riesenverlust, wenn ein Familienmitglied seinen angestammten Platz als
Sohn und Bruder verlässt! Nicht, weil es diesen nicht mehr einnehmen
will, sondern weil es tödlich verunglückt. Schwer ist es nicht nur für
die Eltern zu ertragen, die das Kind verlieren, was sie bisher groß
gezogen und geliebt haben, mit ihm gelacht, geweint, gestritten und sich
versöhnt haben; kurz gesagt, wenn es vor einem geht. Genauso schwer
ertragbar ist es für die Geschwister, die jüngeren Mädchen, die in
diesem Fall ihren großen Bruder, teils ihr Vorbild, verlieren. Besonders
tragisch im Fall von Rowan, da sie diejenige ist, die sich von nun an
kümmern muss. Ihr großer Bruder Jack kommt von einem Ausflug nicht
zurück. Die Mutter kann es so schlecht verkraften, dass sie dabei die
beiden lebenden Kinder Rowan und Stroma vergisst und sich komplett
abschottet. Darüber zerbricht auch der Vater und die Ehe, denn neben
seinem Sohn ebenfalls die Frau zu verlieren, ist mehr als wiederum er verkraften
kann. Seine Töchter lügen ihm allerdings über den Gesundheitszustand der
Mutter etwas vor.
Irgendwann lernt Rowan Harper kennen. Er zieht in einem umgebauten Krankenwagen durch die Welt und zeigt Rowan die andere Seite des Lebens, bringt sie zum Lachen und nimmt ihr auch mal Stroma ab. Er steht ihr helfend zur Seite.
Stroma ist erst 6 und ist sehr frühreif durch die Geschehnisse, aber auch sehr sensibel. Sie möchte ihrer Schwester auch mal einen Gefallen tun und bereitet ihr das Frühstück. Gerührt sieht Rowan ihr dabei zu und verschwindet sofort ins Bett zurück, um Stroma nicht die Überraschung zu verderben, als sie einen Knall und ein Jammern hört. Das Tablett ist heruntergefallen und entsetzt schaut Stroma auf das Ergebnis mit dem Kommentar: „Schau die diese kaputte Suppe an.“ Genauso fühlen sich die beiden manchmal auch in der ganzen Familiensituation. Dann überschlagen sich die Ereignisse. Rowans Mutter unternimmt einen Selbstmordversuch und kann von Glück reden, dass der Vater rechtzeitig dazukommt. Doch weitere Dramen folgen. Und die Lösungen serviert Jenny Valentine gleich mit. Schließlich sieht alles so aus, als bliebe die kaputte Suppe nicht kaputt.
Das Bild der kaputten Suppe ist mutig. Auf das Buch der Jugendautorin möge man es nicht anwenden, wenn auch der Stil ziemlich vorantreibend ist. Es ist eines dieser Bücher, zu denen man den Abstand verlieren muss, dem tiefes Reflektieren nicht bekommt. Dann ist es eindrucksvoll und packend.
Jenny Valentine:
"Kaputte Suppe"
dtv 2010
200 Seiten, Euro 15,00
ISBN: 978-3423247788
![]()
Pia Reinacher (Hg.): "Als wäre er ein anderer gewesen. Zum Werk von Arnold Stadler",
(Arnold Stadler: "Eines Tages, vielleicht auch nachts", Arnold Stadler: "Komm, gehen wir")
Von Markus Ludwig
 Der
Absturz Arnold Stadlers hat mir geradezu körperliche Schmerzen
verursacht. Den 1954 geborenen Schriftsteller aus Baden-Württemberg habe
ich von seinen ersten Veröffentlichungen an verfolgt; die Gedichte, die
ersten Romane, noch bei dem österreichischen Residenzverlag
erschienenen. Allein "Der Tod und ich, wir zwei" (1996) - besser geht's
nicht! Dann 1999 der Büchner-Preis und der Wechsel zu Dumont; die
Bücher werden angepasster, die Sprache öder. Doch 2003 sein bester Roman
(nicht bei Dumont, natürlich nicht, sondern bei Jung und Jung in
Salzburg): „Eines Tages, vielleicht auch nachts“. Grandios! Und seitdem
wird ein Satz nach dem anderen abgeschmackter und humorloser. Wie kann
ein solches Talent so zerstört werden?
Der
Absturz Arnold Stadlers hat mir geradezu körperliche Schmerzen
verursacht. Den 1954 geborenen Schriftsteller aus Baden-Württemberg habe
ich von seinen ersten Veröffentlichungen an verfolgt; die Gedichte, die
ersten Romane, noch bei dem österreichischen Residenzverlag
erschienenen. Allein "Der Tod und ich, wir zwei" (1996) - besser geht's
nicht! Dann 1999 der Büchner-Preis und der Wechsel zu Dumont; die
Bücher werden angepasster, die Sprache öder. Doch 2003 sein bester Roman
(nicht bei Dumont, natürlich nicht, sondern bei Jung und Jung in
Salzburg): „Eines Tages, vielleicht auch nachts“. Grandios! Und seitdem
wird ein Satz nach dem anderen abgeschmackter und humorloser. Wie kann
ein solches Talent so zerstört werden?
Mittlerweile ist Stadler Autor beim Fischer Verlag. Dort ist nun eine
Hymne an ihn erschienen: „Als wäre er ein anderer gewesen. Zum Werk von
Arnold Stadler“ Darin ist vieles gesammelt, was definitiv nie in ein
Buch sollte und dort auch nicht hineingehört – Rezensionen aus
Tageszeitungen zum Beispiel. Aber wer einen Gegenwartsautor feiern will,
muss schmerzfrei sein, und darauf hat sich die Herausgeberin also
konzentriert.
Aber ich suche nach Antworten für meinen Irrtum, ich fühle mich betrogen um all die Gespräche, in denen ich auf Stadler schwor, und ich will geistige Satisfikation für den Moment, als meine Widersacher mir schweigend „Komm, gehen wir“ (Fischer 2007) hinlegten, und ich die ganze Nacht litt, so was lesen zu müssen.
Die Schwäche der Rezensionen und die Namen der Kritiker helfen. Es ist
der bundesdeutsche literarische Betrieb, der sich Stadlers annahm.
Intellektuell machen all diese die Tür hinter sich und ihren ehemals
klingenden Printmedien zu. Von ihnen vereinnahmt, bedeutet verloren für
jüngere Leser. Dann die Literaturpreise! Der erste dieser halbfrei (und
das genügt nicht für Literatur!) vergebenen Dinger ist verheerender für
einen Autor als der nächste. Die Laudatoren, die ganzen alten Säcke,
Martin Walser, Wolfgang Frühwald, Peter Handke (der ginge ja an sich
noch, nur nicht mit dieser Laudatio). Das wäre noch wegzustecken, aber
richtig ernst wird es bei der Verleihung der Ehrendoktorwürde durch
Annette Schavan. Ihre Rede ist das wortgewordene Elend eines
 Staatsautors.
Schavan ist eine Täterin in einem System, das Deutschland von Literatur
und Kultur abschneiden will, das junge Leute knechtet und bluten lässt.
Und selbst, wenn man das nicht so sähe: Keinem Schriftsteller hat je die
Nähe zur Politik gut getan. Das gilt auch für Stadler und auch für die
Bundesrepublik, und jetzt wird es ganz ernst: Einer wie Schavan die Hand
zu geben, ist ein Verrat. Unten kämpfen Menschen um ihr Überleben, auch
ihr kulturelles, und Stadler lässt sich von den Tätern feiern.
Staatsautors.
Schavan ist eine Täterin in einem System, das Deutschland von Literatur
und Kultur abschneiden will, das junge Leute knechtet und bluten lässt.
Und selbst, wenn man das nicht so sähe: Keinem Schriftsteller hat je die
Nähe zur Politik gut getan. Das gilt auch für Stadler und auch für die
Bundesrepublik, und jetzt wird es ganz ernst: Einer wie Schavan die Hand
zu geben, ist ein Verrat. Unten kämpfen Menschen um ihr Überleben, auch
ihr kulturelles, und Stadler lässt sich von den Tätern feiern.
Keinen jüngeren Leser verdient er mehr. Vielleicht genügen ihm die alten und korrumpierten. Vielleicht aber hat er noch die Kraft, sich wieder abzuwenden. Dann würde er auch wieder anders, gut schreiben können. Dann würden wir den Titel „Als wäre er ein anderer gewesen“ lesen als Statusbeschreibung für eine Phase, in der ein erstklassiger Dichter ein hundsmiserabler Clown für die Nomenklatura war. Eine Phase nur.
Pia Reinacher (Hg.):
"Als wäre er ein anderer gewesen"
Fischer Verlag 2009
381 S., Euro 9,95
ISBN 978-3596180868
Arnold Stadler:
"Eines Tages, vielleicht auch nachts "
Fischer Verlag 2005
188 S., Euro 8,90
ISBN 978-3596165759
Arnold Stadler:
"Komm, gehen wir"
Fischer Verlag 2009
400 S., Euro 9,95
ISBN 978-3596175727
![]()
Einfallsreichtum vs. Erkenntnis
Clemens J. Setz erzählt in "Die Frequenzen" vom Schicksal zweier junger Männer - mit großem Einfallsreichtum, der manchmal übers Ziel hinausschießt
Von Fabian Thomas
 Clemens
J. Setz hat sich viel vorgenommen: Sein zweiter Roman nach „Söhne und
Planeten“ (2007) hat 77 Kapitel, die sich auf drei große Blöcke
verteilen und insgesamt 714 Seiten füllen. Die Hauptfiguren in dem
beeindruckend dicken Roman des 1982 geborenen Österreichers sind mehr
oder weniger exzentrische Charaktere, um die sich das nicht minder
exotische Personal des Romans schart. Walter ist der Sohn eines
Architekten, auf den ersten Seiten erleben wir ihn auf der Heimreise zu
seinem Elternhaus, dessen verwilderter Garten von Rebhühnern bevölkert
wird. Er hat mit den schon früh an ihn gestellten künstlerischen
Herausforderungen zu kämpfen, versucht sich eine Zeitlang als
Schriftsteller, verbrachte einige Monate in Paris und hat wechselnde
bisexuelle Verhältnisse. Seinen künstlerisch anspruchsvollen Eltern
gegenüber gibt er an, als Schauspieler zu arbeiten – tatsächlich hat er
gerade sein Engagement bei der Psychologin Valerie verloren, für die er
als Laiendarsteller vor Patientengruppen agiert hat. Alexander hat auch
gerade seinen Job als Altenpfleger quittiert; von ihm erfährt man
reichliche Kindheitsgeschichten, die an dem Punkt kulminieren, als sein
Vater, ein zerstreuter Physikprofessor, spurlos verschwindet. Zuvor hat
er sich mit wissenschaftlichem Eifer einem mysteriösen Riss im Keller
gewidmet, der seine Zurechnungsfähigkeit und den Familienfrieden vor
eine Zerreißprobe gestellt hat. Zu Alexanders Vorlieben dagegen zählt
das Anrufen der Zeitansage, um sich aus unliebsamen Gesprächen
zurückzuziehen und die Beschäftigung mit sogenannten Snuff-Websites, auf
denen inszenierte Hinrichtungen in Videodateien diskutiert werden.
Clemens
J. Setz hat sich viel vorgenommen: Sein zweiter Roman nach „Söhne und
Planeten“ (2007) hat 77 Kapitel, die sich auf drei große Blöcke
verteilen und insgesamt 714 Seiten füllen. Die Hauptfiguren in dem
beeindruckend dicken Roman des 1982 geborenen Österreichers sind mehr
oder weniger exzentrische Charaktere, um die sich das nicht minder
exotische Personal des Romans schart. Walter ist der Sohn eines
Architekten, auf den ersten Seiten erleben wir ihn auf der Heimreise zu
seinem Elternhaus, dessen verwilderter Garten von Rebhühnern bevölkert
wird. Er hat mit den schon früh an ihn gestellten künstlerischen
Herausforderungen zu kämpfen, versucht sich eine Zeitlang als
Schriftsteller, verbrachte einige Monate in Paris und hat wechselnde
bisexuelle Verhältnisse. Seinen künstlerisch anspruchsvollen Eltern
gegenüber gibt er an, als Schauspieler zu arbeiten – tatsächlich hat er
gerade sein Engagement bei der Psychologin Valerie verloren, für die er
als Laiendarsteller vor Patientengruppen agiert hat. Alexander hat auch
gerade seinen Job als Altenpfleger quittiert; von ihm erfährt man
reichliche Kindheitsgeschichten, die an dem Punkt kulminieren, als sein
Vater, ein zerstreuter Physikprofessor, spurlos verschwindet. Zuvor hat
er sich mit wissenschaftlichem Eifer einem mysteriösen Riss im Keller
gewidmet, der seine Zurechnungsfähigkeit und den Familienfrieden vor
eine Zerreißprobe gestellt hat. Zu Alexanders Vorlieben dagegen zählt
das Anrufen der Zeitansage, um sich aus unliebsamen Gesprächen
zurückzuziehen und die Beschäftigung mit sogenannten Snuff-Websites, auf
denen inszenierte Hinrichtungen in Videodateien diskutiert werden.
Beide Erzählstränge wechseln sich meist kapitelweise ab, wobei Walters Teil durchgängig aus der Er-Perspektive, Alexanders Teil dagegen als Ich-Erzählung wiedergegeben werden. Dabei werden die Handlungsfäden mehrfach enggeführt: so die Bekanntschaft der Eltern Walters und Alexanders, und das Verhältnis Alexanders mit Valerie, der Chefin von Walter. Hier geht Clemens J. Setz kompositorisch virtuos vor; an den zahlreichen weiteren miteinander verwobenen Handlungssträngen droht der Leser dagegen zwangsläufig den Überblick zu verlieren. Als Nebenfiguren werden eingeführt: Wilhelm Steiner, der Vermieter von Alex, der seit dem Tod seiner Frau den Verstand verloren hat; Gabi, eine Patientin Valeries mit einer Tinnitus-Erkrankung, die sich in Walter verliebt; Valeries Vater, der im Architekturbüro von Walters Vater gearbeitet hat und ebenfalls den Verstand verliert; Uljana, seine Hündin, aus dessen Perspektive mehrere Szenen erzählt werden; Gerald Katzek, der Sohn einer Nachbarin von Alex, der auf seinem Handy einen Überfall auf Valerie filmt. Diese, eine Schlüsselszene des Romans, markiert die Stelle, an der die Verschränkung der Handlung auf ein Maximum angewachsen ist und nur noch schwer durchschaut werden kann. Festzustehen scheint, dass Valerie den Überfall nicht überlebt und danach sowohl Walter wie auch Alexander ihre ohnehin auf losem Fundament basierenden Lebensentwürfe zum Scheitern verurteilt sehen.
Eine nur wenig zufriedenstellende Erkenntnis nach 714 Seiten Lektüre, die für Die Frequenzen aufzubringen sind. Der Einfallsreichtum von Clemens J. Setz ist beeindruckend, sein Mut, auch kleinste Details auszuschmücken und zu Sub-Erzählungen auszubauen, ebenfalls. Leider hat man es als Leser aber nicht immer leicht, den verschlungenen Wegen der Helden dieses Romans zu folgen. Vielleicht bietet der nächste Roman diese hier noch fehlende Balance auf.
Clemens J. Setz:
"Die Frequenzen"
Residenz Verlag 2009
714 S., Euro 24,90
ISBN 978-3701715152
![]()
Rowohlt marketingt sich ein Buch
Uli Franz: Die Asche meines Vaters
Von Urs Nägeli
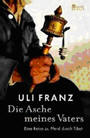 Wow - ist schon das erste, was man denkt,
wenn man über, über das Buch von Uli Franz - "Die Asche meines Vaters"
liest. Der Vater stirbt, sein letzter Wille: Der Sohn solle seine Asche
in Tibet verstreuen. Nun ein Buch über diese abenteuerliche Reise in das
ferne, besetzte Tibet, noch auf einem Pferd als Fortbewegungsmittel. Der
Reisende (und Buchautor bereits zu Tibet) erfüllt seine Mission, kehrt
zurück und schreibt nieder, was ihm widerfahren. Cool!
Wow - ist schon das erste, was man denkt,
wenn man über, über das Buch von Uli Franz - "Die Asche meines Vaters"
liest. Der Vater stirbt, sein letzter Wille: Der Sohn solle seine Asche
in Tibet verstreuen. Nun ein Buch über diese abenteuerliche Reise in das
ferne, besetzte Tibet, noch auf einem Pferd als Fortbewegungsmittel. Der
Reisende (und Buchautor bereits zu Tibet) erfüllt seine Mission, kehrt
zurück und schreibt nieder, was ihm widerfahren. Cool!
Doch wenn man in, in dem Buch liest, stellen sich gleich buchinhalts-existentielle Fragen. Man dachte: Uli Franz ist vielleicht Halb-Tibeter. Ist er nicht. Ein deutsches Leben in einem deutschen Denken, und der Tibetwunsch des Vaters - das wirkt wie eine Fertigmischung Dr. Oetker-Rowohltreisebuch. Die Kleintüte mit dem Buddhismus-Gewürz als letztes herein: Nun kann gebestsellert werden. Ein Marketingstunt, erdacht von den Verkaufsstrategen. Sauber zusammengemixt.
Es ist mühevoll, aber man kann versuchen, das Buch hinter den Ladentischtricks zu sehen. Man erhält dann Einblicke in einen tief unsympathischen Menschen, der Frauen gegenüber unsauber, speckig, geschwätzig, neunmalklug und geizig ist. Der die Pferde wie Weggefährten nur benutzt, um seine Ziele zu erreichen und keine engen Beziehungen aufbaut, niemals Dankbarkeit empfindet und keine Verantwortung übernimmt, der sich Mystik bedient, um sein eigenes Leben erträglich zu machen. Buddhismus als Lebensabschnittspartner. Am ehrlichsten wirkt die Bedankung an seinen Sponsor.
Wäre eine Verbeugung gegenüber den Lektoren angemessen? Haben sie dieses genau berechnete Buch runter- oder hochredigiert? Das Spannungskonzept bleibt das ganze Buch über bestehen, und die Verkaufsförderungsidee auch.
Es kann ein Bestseller werden. Aber das ist uns total egal.
Uli Franz:
"Die Asche meines Vaters"
Rowohlt Verlag 2009
288 S., Euro 19,90
ISBN 978-3871345951
![]()
Jan Off: Unzucht
Von Anne Spitzner
 Krank. Widerwärtig. Ekelhaft. All das mag einem durch den Kopf gehen,
wenn man die ersten Seiten von Jan Offs Roman „Unzucht“ liest – all das
mag man denken, und es wäre nicht die Unwahrheit. „Unzucht“ steckt
voller Wörter, bei denen unsere Mütter über und über rot geworden wären,
steckt voller kranker sexueller Phantasien, für die sich normale
Menschen schämen, lässt Perversion aus jeder einzelnen Zeile triefen. Es
ist ein Buch wie ein Unfall – es ist grausam, es ist Ekel erregend, aber
man kann den Blick einfach nicht davon abwenden.
Krank. Widerwärtig. Ekelhaft. All das mag einem durch den Kopf gehen,
wenn man die ersten Seiten von Jan Offs Roman „Unzucht“ liest – all das
mag man denken, und es wäre nicht die Unwahrheit. „Unzucht“ steckt
voller Wörter, bei denen unsere Mütter über und über rot geworden wären,
steckt voller kranker sexueller Phantasien, für die sich normale
Menschen schämen, lässt Perversion aus jeder einzelnen Zeile triefen. Es
ist ein Buch wie ein Unfall – es ist grausam, es ist Ekel erregend, aber
man kann den Blick einfach nicht davon abwenden.
So weit der erste Eindruck. Erst, wenn Neugier, Voyeurismus oder der Wille gesiegt haben, ein begonnenes Buch auch zu Ende zu lesen – man nenne es, wie man will – erkennt man, dass der erste Eindruck trügt.
Allerdings nicht ganz. Es ist immer noch wahr, dass „Unzucht“ auf weniger als 200 Seiten mehr erschreckende Sex- und Drogenfantasien vereint als die meisten Pornohefte oder –filme. Aber gleichzeitig erzählt es auch eine Geschichte – eine Geschichte, in der es nicht um Sex geht, sondern um die Suche nach Nähe, die jemand als Sex missversteht. Sie spielt in einer Zeit, in der uns in jeder Werbeanzeige, in jedem Hollywood-Film und in jeder Sitzung beim Psychoanalytiker erzählt wird, dass Sex der Schlüssel zur Lösung aller unserer Probleme sei, in einer Zeit, die vergessen hat, dass es ganz andere Gründe dafür gibt: die Vereinigung zweier Menschen, die sich lieben, und/oder das Zeugen von Nachwuchs. Doch hier gehen diese elementaren Regeln verloren; hier ist Sex eine Freizeitbeschäftigung, ein Weg aus der Langeweile, eine Ausflucht, wenn die Hose drückt. Hier wird „gefickt“ und „gevögelt“, und die Geschlechtsorgane erhalten Namen, die man sonst höchstens als Schimpfwörter aus Hip-Hop-Texten kennt.
„Unzucht“ erzählt die Geschichte eines namenlosen Ich-Erzählers, der in eine rein sexuelle Beziehung mit einer bisher Fremden gerät. Er wird von der Freundin eines Kumpels verführt und verliert sein reales Leben aus den Augen. Haltlos treibt er umher, mit jeder Frau schlafend, die ihm über den Weg läuft und die sich nicht abgeneigt zeigt, bis er auf Tanja trifft, seine Sexbeziehungspartnerin. Mit ihr testet er seine – und ihre – Grenzen jedes Mal ein Stückchen weiter aus und merkt nicht, wie sehr er dabei in eine kranke Welt abgleitet, die nichts mehr mit der Realität zu tun hat. Es ist traurig, zu sehen, wie Menschen den ultimativen Kick suchen und ihn im Sex finden, egal, wie brutal oder entwürdigend er ist, und sie das noch nicht einmal selbst merken. Zwischendurch bahnt sich so etwas wie Zweisamkeit an, gibt es Gefühle, die im nächsten Augenblick wieder verschwinden, weil beide sie nicht wollen – oder vielleicht doch wollen und es sich selbst nicht eingestehen (können).
Doch auch wenn der Sex in „Unzucht“ eindeutig im Vordergrund steht, ist der Hintergrund nicht unbedingt dazu angetan, die Geschichte versöhnlicher wirken zu lassen. Der Protagonist ist ein „Aushilfsliterat“, der keine feste Arbeit hat und so gut wie ständig pleite ist, sein weniges Geld in Alkohol, Zigaretten, Gras und Koks investiert und in verschiedene Wege, Frauen, die er in Clubs aufgegabelt hat, ins Bett zu kriegen. Doch in Wirklichkeit ist er allein, und er bleibt allein.
Bei aller vulgären Obszönität ist „Unzucht“ dennoch eine gelungene Erzählung. Packend, wie der Autor den Leser mit in die Rauschzustände seines Protagonisten nimmt, seien sie sexueller Natur oder durch Drogen herbeigeführt. Jan Off pendelt beständig zwischen Poesie und Porno, erzählt mit knallhart aufgesetzter Abgebrühtheit die Geschichte des Namenlosen, erzählt von einer Generation, deren Erlösung im Sex besteht und die doch keine Erlösung finden kann. Sex bedeutet Besessenheit, bedeutet Krankheit und Kaputtsein. Und doch ist er das Allerwichtigste.
Zusammenfassend lässt sich also sagen: für dementsprechend Interessierte könnte „Unzucht“ einen verbalen Porno darstellen; für Leser aus jener Generation, die genauso von den Medien verdorben wurden wie Jan Offs Ich-Erzähler, für offenere Leser, die sich nicht gleich an jedem „unanständigen“ Wort stören, ist „Unzucht“ jedoch eine beklemmende, furchteinflößende Seelenstudie und auf jeden Fall empfehlenswert.
Jan Off:
"Unzucht"
Ventil Verlag 2009
174 Seiten, Euro 11,90
ISBN 978-3931555634
![]()
Keine Frau, mit der man näher zu tun haben möchte
Eine Deutsche im Heidiland
Von Verena Zürcher
 Die
Idee, ein Buch über eine Deutsche zu schreiben, welche im globalisierten
Arbeitsmarkt in die „reiche“ Schweiz reist, um hier ihrem Beruf als
Ärztin nachzugehen, tönt ja noch spannend. Denn der Trend, dass
deutsche, in der Heimat schlecht bezahlte Arbeitskräfte im „Heidiland“
anheuern, ist nachweisbar. Und demnach ist das Thema auch gerade Mode.
Doch leider gelingt es der deutschen Autorin Susanne Fengler, welche
selber längere Zeit in der Schweiz gelebt hat, auch nach hundert Seiten
nicht, diese Spannung aufzubauen, zu vermitteln.
Die
Idee, ein Buch über eine Deutsche zu schreiben, welche im globalisierten
Arbeitsmarkt in die „reiche“ Schweiz reist, um hier ihrem Beruf als
Ärztin nachzugehen, tönt ja noch spannend. Denn der Trend, dass
deutsche, in der Heimat schlecht bezahlte Arbeitskräfte im „Heidiland“
anheuern, ist nachweisbar. Und demnach ist das Thema auch gerade Mode.
Doch leider gelingt es der deutschen Autorin Susanne Fengler, welche
selber längere Zeit in der Schweiz gelebt hat, auch nach hundert Seiten
nicht, diese Spannung aufzubauen, zu vermitteln.
Die Protagonistin Ilka, Ärztin an einer Berliner Klinik, liiert mit einem langweiligen Möchtegern-Karriere-Jurist namens Stefan, ist nun einfach keine Frau, mit der man näher zu tun haben möchte, nicht als Ärztin, nicht als Freundin, nicht als Frau. Oberflächlich, leicht hysterisch pufft sie durchs Leben, und manchmal, so sagt sie, bestehe ihr „Kopf nur noch aus schwarzem Pudding“. Wie wahr!
Nun, auf jeden Fall lässt sie sich locken, zieht als Wochenaufenthalterin nach Zürich, um dort zu arbeiten. Das ist ein Teil der Geschichte.
Endgültig zu schwarzem Pudding wird das Buch, wenn die Autorin sich auf das Kult-Kinderbuch „Heidi“ von Johanna Spyri besinnt und Ilka Fuchs’ launischen, rechthaberischen und geldgierigen Vater Fred als Erfolgsgeheimnis für die geplante Geschäftsexpansion nach Moldawien eben diese Geschichte einflössen lässt.
Das ist zu viel des Guten! Die Story vermag den Leser nicht zu fesseln. Dabei hat Susanne Fengler mit ihrem Buch „Fräulein Schröder“ durchaus bewiesen, dass sie was kann. Auch schreiben kann die 36-jährige Deutsche. Oft gelingen ihr wirklich gute Sätze, Bilder. Manchmal aber verheddert sich die Autorin ganz offensichtlich in ihren eigenen Gedanken und die Protagonisten flattern durchs Leben wie aufgeschreckte Hühner. Und manchmal kommt die Geschichte daher wie ein Dreigroschenroman.
Als Schweizer Leser hat man es doppelt schwer: Da werden althergebrachte Klischees aufgetischt, die man einfach nicht mehr hören mag. Es ist nicht so, dass sich im Land von Käse, Schokolade, Uhren und Banken alles nur ums Geld dreht. – Auch wenn man dies im Rest der Welt so zur Kenntnis nehmen sollte.
Bleibt als einzige Spannung das Frustpotential der Protagonistin, welche, zwischen Zürich und Berlin pendelnd, irgendwann spürt, dass auch in der Schweiz nicht alles Gold ist, was glänzt. Aber Ilka Fuchs bleibt eine Protagonistin, die dem Leser nie näher kommt, weil es die Autorin versäumt, einem diese Ärztin aus Berlin näher zu bringen. Da sitzt sie also alleine in ihrer Einzimmerwohnung in Zürich, derweil ihr träger Freund Stefan in Berlin so halbherzig auf die Idee kommt, auch in seinem Leben etwas zu verändern, und zu diesem Zweck mit andern Frauen liebäugelt. Doch, es wäre wohl zu viel verlangt, wenn der Kracher gegen Ende des Buches noch eintreffen täte. Leider bleibt der aus; denn nach über 300 Seiten an eine Hochzeit zwischen Ilka und Stefan zu denken, ist zum Gähnen. Vor allem dann, wenn der Termin just auf den 1. August, den Schweizer Nationalfeiertag, festgelegt werden soll.
Susanne Fengler:
"Heidiland"
Gustav Kiepenheuer-Verlag 2008
347 S., Euro 19,95
ISBN 978-3378006843
Die Rezensentin ist Journalistin, Buchautorin und Verlegerin. Näheres unter
WorldWideWeb.landverlag.ch
![]()
Ortheils "Verlangen nach Liebe"
Von Carsten Dürer
 Hanns-Josef Ortheil ist einer der zeitgenössischen deutschen
Schriftsteller. Und – wie sollte es anders sein – auch ihn beschäftigt
das Thema Liebe immer wieder. Dieses Thema griff er bereits in seinem
2003 geschriebenen Roman „Die große Liebe“ auf und führt es nun wieder
in seinem neuesten Roman „Das Verlangen nach Liebe“ ein. Ortheil
allerdings hat noch eine andere große Liebe aus seiner Jugend: Die
Musik. Bereits mit 15 gab er Klavierkonzerte. Doch letztendlich wurde
der Wunsch, Pianist zu werden, aufgrund von Sehnenscheiden-entzündungen
vereitelt. Die Musik wird immer wieder in seinen Romanen angerissen,
immerhin versteht der Autor eine Menge vom Spiel, von der Musik, den
Gefühlen, die damit einhergehen. Nun hat er in seinem neuesten Roman
„Das Verlangen nach Liebe“ nicht allein die Liebe an sich, sondern auch
das Pianistentum thematisiert. Denn der Protagonist, Johannes, ist
erfolgreicher Konzertpianist, der in Zürich auf seine ehemalige große
Liebe Judith trifft, die mittlerweile erfolgreiche Kunsthistorikerin ist
und in Zürich einen Ausstellung betreut. Ein Zufall, wie er im Leben
schon einmal passieren kann. Getrennt hatten die beiden sich, da Judith
untreu war, Johannes sie wortlos verließ. Nun kommen alle alten Gefühle
hoch, fragt sich der Pianist, ob diese Liebe wieder wie in alten Zeiten
aufleben kann. Und sie tut es. Allerdings genau dies stört immens, wenn
der Leser – und bei Ortheil kann man davon ausgehen – ein eher
kritisch-intellektueller ist und nicht in die Kategorie „Liebesroman“ à
la Utta Danella gehört. Denn es ist alles zu leicht nach den 18 Jahren
der Trennung, des Nichtsehens, dass diese beiden Individualisten sich
wieder zusammensetzen, sich wieder lieben lernen. Fast ist es
trügerisch, denkt man und erwartet eine große Komplikation, die die
Dramaturgie der Geschichte vorantreibt, Spannung erzeugt.
Hanns-Josef Ortheil ist einer der zeitgenössischen deutschen
Schriftsteller. Und – wie sollte es anders sein – auch ihn beschäftigt
das Thema Liebe immer wieder. Dieses Thema griff er bereits in seinem
2003 geschriebenen Roman „Die große Liebe“ auf und führt es nun wieder
in seinem neuesten Roman „Das Verlangen nach Liebe“ ein. Ortheil
allerdings hat noch eine andere große Liebe aus seiner Jugend: Die
Musik. Bereits mit 15 gab er Klavierkonzerte. Doch letztendlich wurde
der Wunsch, Pianist zu werden, aufgrund von Sehnenscheiden-entzündungen
vereitelt. Die Musik wird immer wieder in seinen Romanen angerissen,
immerhin versteht der Autor eine Menge vom Spiel, von der Musik, den
Gefühlen, die damit einhergehen. Nun hat er in seinem neuesten Roman
„Das Verlangen nach Liebe“ nicht allein die Liebe an sich, sondern auch
das Pianistentum thematisiert. Denn der Protagonist, Johannes, ist
erfolgreicher Konzertpianist, der in Zürich auf seine ehemalige große
Liebe Judith trifft, die mittlerweile erfolgreiche Kunsthistorikerin ist
und in Zürich einen Ausstellung betreut. Ein Zufall, wie er im Leben
schon einmal passieren kann. Getrennt hatten die beiden sich, da Judith
untreu war, Johannes sie wortlos verließ. Nun kommen alle alten Gefühle
hoch, fragt sich der Pianist, ob diese Liebe wieder wie in alten Zeiten
aufleben kann. Und sie tut es. Allerdings genau dies stört immens, wenn
der Leser – und bei Ortheil kann man davon ausgehen – ein eher
kritisch-intellektueller ist und nicht in die Kategorie „Liebesroman“ à
la Utta Danella gehört. Denn es ist alles zu leicht nach den 18 Jahren
der Trennung, des Nichtsehens, dass diese beiden Individualisten sich
wieder zusammensetzen, sich wieder lieben lernen. Fast ist es
trügerisch, denkt man und erwartet eine große Komplikation, die die
Dramaturgie der Geschichte vorantreibt, Spannung erzeugt.
Und wenn er durch Zürich geht ist wohl der Zürichsee und seine immer wieder angesprochene Schönheit eines der zentralen Momente dieses Romans. Doch allein eine Liebeserklärung an die Stadt Zürich, verpackt in eine Liebesgeschichte? Nicht ganz. Aber die Konflikte bleiben in der monologisierten Gedankenwelt des Pianisten haften. Konflikte mit Judith? Keineswegs, oder zumindest nur angedeutet am Ende. Allein das recht flach dargestellte Verhältnis zu seiner Agentin, die er zu Beginn aufgrund von falscher Scham belügt, scheint Konfliktpotenzial zu bergen. Aber auch hier wird keines heraufbeschworen. Die Geschichte schwebt auf einer rosaroten Wolke, die bereits in der Mitte des Buches zu langweilen beginnt, auch wenn man eine Reise durch den Charakter des Pianisten Johannes unternimmt. Aber warum, wozu? Um zu lesen, wie sich Musik auf einen Pianisten auswirkt, wie er die Musik empfindet, sie im Essen in den zahlreichen beschriebenen Restaurants wiederfindet? Das ist so sehr individuell, dass auch diese Anspielungen eher ein Ausdruck dafür sind, dass der Autor zeigen will, wie viel er angeblich über Musik versteht und dies auch zeigen will.
Doch was den Musikliebhaber, dem dieses Buch in die Finger fällt viel mehr stört: Die Kollegenschelte und das Kollegenlob, die Ortheil seinen Protagonisten denken und aussprechen lässt. Sicherlich kann man mal erwähnen, dass man das Spiel von Christian Zacharias nicht so sehr mag, aber wenn es mehrfach erwähnt wird, scheint dahinter eine Art Abrechnungsprogrammatik zu stecken. Und dass ein Bruno Leonardo Gelber der größte Schumann. Interpret sei, mag nun wirklich dahingestellt bleiben. Doch wer sich nicht so auskennt, der nimmt doch solche Aussagen als Wahrheiten wahr. Was soll das, was will Ortheil damit bewirken? Könnte er nicht auch fiktive Namen nehmen, die vielleicht den Vergleich mit einem lebenden Pianisten zulassen? Der überhaupt im gesamten Buch fehlende Realitätsanspruch wird dadurch nicht unbedingt verstärkt. Apropos Realitätsanspruch: Ein Pianist, der erfolgreich ist, hat heutzutage keine Zeit eine Woche in einer Stadt zu verbringen, in der er nur ein Konzert gibt. Das ist unwirklich! Zudem ist die Zürcher Tonhalle als Hauptkonzertsaal beständig bespielt – wie kann es also sein, dass der Pianist immer dann, wenn er gerade Lust empfindet in den großen Saal gehen kann, und der Konzertflügel steht gestimmt bereit für ihn? Das ist so irreal wie es kaum unwirklicher sein könnte. Selbst wenn ein Pianist eine gewisse Berühmtheit besitzt, hat er Schwierigkeiten, einen Tag vor seinem Konzert eine lange Probe im Saal zu absolvieren. Und das ist sicherlich nur einmalig möglich, nicht über eine Woche.
Natürlich ist Ortheil ein brillanter Schreiber, einer, der der Sprache mächtig ist und diese virtuos einsetzt. Allein: Der Plot langweilt dieses Mal, ist eingebettet in eine Geschichte, die so fließend ohne Ecken und Kanten, sprich ohne dramatische Aspekte seitens Spannung und Konflikten daher kommt, dass dieses Buch wirklich dann doch eher etwas für die Leserklientel ist, die sich in eine unreale Welt der großen Gefühle begeben möchte, die es so nun wirklich nicht gibt. Man kann nur hoffen, dass Ortheil in seinen kommenden Büchern nicht auf diese nach Schnellschuss riechende Schreibweise verfällt. Es wäre schade um einen guten deutschen Autor, der bislang wirklich große Literatur verfasst hat.
Hanns-Josef Ortheil:
"Das Verlangen nach Liebe"
Luchterhand Verlag 2007
320 S., Euro 19,95.-
ISBN: 9783630872636
Der Rezensent ist Chefredakteur der Zeitschrift „Piano News“.
copyright by librithek
